Dienstag, Oktober 31, 2006
Montag, Oktober 30, 2006
Revolver reading
Revolvermann Nomak hat sich mit unkonventionellen Drogen gerüstet und ist ans Ende der Nacht gereist, um den Text Kür zu vertonen. Starke Stimme. Starke Musik.
--
>> Nomak
>> Blog:Read
--
>> Nomak
>> Blog:Read
Sonntag, Oktober 29, 2006
Das rebellische Wort
Es beginnt mit den zwei ersten Buchstaben des Alphabets. Nur zum Schein tarnt es sich am Ende mit einem männlichen Geschlechtsmerkmal. Es kann alles in Frage stellen und lässt keine Behauptung gelten, die sich vor ihm aufbäumt. Es ist klug, denn in der Regel hört es sich an, was die Wörter zu sagen haben, die das Parkett des Zeitlichen vor ihm betreten. Nur manchmal wird es ungeduldig und schlägt eine Kerbe zwischen zwei Wörter auf einem fremden Satzterrain.
Es besitzt die Macht, Weltgebäude zum Einstürzen zu bringen und ist stärker als der Geist, der stets nur verneint, denn es kann schwere Container mit Argumenten hinter sich herziehen. Sein Erfolg hängt jedoch von der Qualität der Containerladung ab.
Es besitzt einen beeindruckenden Klang, egal in welche Tonlage man es kleidet. Wird es in die Welt gebrüllt, kann es Furcht verbreiten, am ehesten überzeugt es im sachlichen Gewand, geflüstert versprüht es einen bösartigen Charme. Selbst wenn es sich in einem stotternden Rhythmus bewegt, verfehlt es seine Wirkung selten.
Vielleicht ist es das wichtigste Wort überhaupt, aber ...
Es besitzt die Macht, Weltgebäude zum Einstürzen zu bringen und ist stärker als der Geist, der stets nur verneint, denn es kann schwere Container mit Argumenten hinter sich herziehen. Sein Erfolg hängt jedoch von der Qualität der Containerladung ab.
Es besitzt einen beeindruckenden Klang, egal in welche Tonlage man es kleidet. Wird es in die Welt gebrüllt, kann es Furcht verbreiten, am ehesten überzeugt es im sachlichen Gewand, geflüstert versprüht es einen bösartigen Charme. Selbst wenn es sich in einem stotternden Rhythmus bewegt, verfehlt es seine Wirkung selten.
Vielleicht ist es das wichtigste Wort überhaupt, aber ...
Samstag, Oktober 28, 2006
Höhenlichter
1. Entwarnung: Eine Woche nach Erscheinen des Beitrags über Neonazi-Propaganda finde ich mit einer Ausnahme (Suchbegriff Sturmwehr) keine der genannten Volksverhetzer mehr auf der Plattform. Bravo, Youtube! Braunes Pack: Ein gewisser Herr Hitler will euch sprechen. Schaut doch einfach persönlich in seinem tausendjährigen Reich vorbei.
2. Seemannskost: Ein Dissonanzident und Kakophonist serviert vieille cuisine auf dem Plattenteller.
3. Luftfahrt I: Im Rheinland werden Ressentiments über Underdoves korrigiert.
4. Luftfahrt II: Pfauenauge beim Flug durch Frankfurt beobachtet.
5. Clubausweis:

2. Seemannskost: Ein Dissonanzident und Kakophonist serviert vieille cuisine auf dem Plattenteller.
3. Luftfahrt I: Im Rheinland werden Ressentiments über Underdoves korrigiert.
4. Luftfahrt II: Pfauenauge beim Flug durch Frankfurt beobachtet.
5. Clubausweis:

Freitag, Oktober 27, 2006
Donnerstag, Oktober 26, 2006
Diktatoren-Quartett
Quartettspiele gehörten zu den Zeitvertreibern meiner Kindheit. Wie jeden normalen Jungen faszinierte mich schweres Kriegsgerät, meine bevorzugten Kartensätze waren das Kriegsmarine-, und das Panzer-Quartett. Vom Gewicht einer Bruttoregistertonne hatte ich keine Vorstellung, aber schon das Wort klang mordsmäßig schwergewichtig.
Die beiden Top-Trümpfe waren der Leopard 2 und der Flugzeugträger USS Enterprise. Und dann gab es noch das Motorrad-Quartett mit der Bol d´Or als Top-Trumpf. Einige Jahre später klappte der Seitenständer einer CB 750 Four in einer Linkskurve unvermittelt herunter und zwang mich bei Tempo 110 zum absteigen. Seiher bin ich auf keiner Honda mehr gesessen.
Besonders während der sommerlichen Busfahrten ins Messdiener-Zeltlager wurden die Quartettspiele im Unterhaltungswert nur von den Sexheftchen übertroffen, die heimlich zwischen den Sitzen durchgereicht wurden.
Später ist man in Sachen Kartenspiele dann auf Schafkopf umgestiegen. Während meiner Lernphase habe ich im Alter von dreizehn Jahren 40.000 Mark an einem einzigen Schafkopf-Nachmittag verloren. Die drei Spezis wollten Geld sehen und zur Not mein Fahrrad beschlagnahmen. Aber ich habe diese Spielschuld selbstverständlich nie beglichen, weil mir meine Ehre damals schon hinreichend schnuppe war. Außerdem bin ich heute noch davon überzeugt, dass die drei geschummelt haben und dafür in die Hölle kommen.
Wenn ich ansatzweise an den Schwachsinn glauben würde, wollte ich in den Himmel kommen, weil inzwischen jeder Depp lieber in die Hölle will, und ich keine Lust habe, die ganzen Deppen nach dem großen Vorhang wieder zu sehen.
 Aber als moralisch verwahrloster Nihilist komme ich sowieso nirgends hin. Und das finde ich gut, weil mir dann auch persönliche Begegnungen mit den Herren aus dem Diktatoren-Quartett erspart bleiben, denn vermutlich verbannt man diese Kerle zur Höchststrafe in den Himmel.
Aber als moralisch verwahrloster Nihilist komme ich sowieso nirgends hin. Und das finde ich gut, weil mir dann auch persönliche Begegnungen mit den Herren aus dem Diktatoren-Quartett erspart bleiben, denn vermutlich verbannt man diese Kerle zur Höchststrafe in den Himmel.
Es ist übrigens tatsächlich keine einzige Dame im Spiel versammelt.
--
>> Diktatoren-Quartett
>> Dictator-Cards
>> Диктатор
Die beiden Top-Trümpfe waren der Leopard 2 und der Flugzeugträger USS Enterprise. Und dann gab es noch das Motorrad-Quartett mit der Bol d´Or als Top-Trumpf. Einige Jahre später klappte der Seitenständer einer CB 750 Four in einer Linkskurve unvermittelt herunter und zwang mich bei Tempo 110 zum absteigen. Seiher bin ich auf keiner Honda mehr gesessen.
Besonders während der sommerlichen Busfahrten ins Messdiener-Zeltlager wurden die Quartettspiele im Unterhaltungswert nur von den Sexheftchen übertroffen, die heimlich zwischen den Sitzen durchgereicht wurden.
Später ist man in Sachen Kartenspiele dann auf Schafkopf umgestiegen. Während meiner Lernphase habe ich im Alter von dreizehn Jahren 40.000 Mark an einem einzigen Schafkopf-Nachmittag verloren. Die drei Spezis wollten Geld sehen und zur Not mein Fahrrad beschlagnahmen. Aber ich habe diese Spielschuld selbstverständlich nie beglichen, weil mir meine Ehre damals schon hinreichend schnuppe war. Außerdem bin ich heute noch davon überzeugt, dass die drei geschummelt haben und dafür in die Hölle kommen.
Wenn ich ansatzweise an den Schwachsinn glauben würde, wollte ich in den Himmel kommen, weil inzwischen jeder Depp lieber in die Hölle will, und ich keine Lust habe, die ganzen Deppen nach dem großen Vorhang wieder zu sehen.
 Aber als moralisch verwahrloster Nihilist komme ich sowieso nirgends hin. Und das finde ich gut, weil mir dann auch persönliche Begegnungen mit den Herren aus dem Diktatoren-Quartett erspart bleiben, denn vermutlich verbannt man diese Kerle zur Höchststrafe in den Himmel.
Aber als moralisch verwahrloster Nihilist komme ich sowieso nirgends hin. Und das finde ich gut, weil mir dann auch persönliche Begegnungen mit den Herren aus dem Diktatoren-Quartett erspart bleiben, denn vermutlich verbannt man diese Kerle zur Höchststrafe in den Himmel.Es ist übrigens tatsächlich keine einzige Dame im Spiel versammelt.
--
>> Diktatoren-Quartett
>> Dictator-Cards
>> Диктатор
Mittwoch, Oktober 25, 2006
Havarie in der Arche
Von Beginn an musste sich Haon beim Bau des Weltenschiffs mit den größten Schwierigkeiten auseinandersetzen, angefangen bei der Risikofinanzierung, für die sich anfangs keine Investoren finden ließen, bis hin zur Materialbeschaffung und der Verpflichtung von Raumzeitmechanikern, die das notwendige Fachwissen besaßen. Aber es gelang ihm, das Projekt gegen alle Widerstände zu starten. Die Investoren täuschte er mit einem fingierten Geschäftsmodell, das seinen Weltraumsegler als interdimensionales Kreuzfahrtschiff auswies. In jener Epoche des ungezügelten Hedonismus erfreuten sich Vergnügungsreisen bei seiner Spezies zunehmender Beliebtheit, und bereits nach wenigen Gesprächen waren in einem der fernöstlichen Sektoren Finanziers für den vermeintlichen Zukunftsmarkt gefunden.
Sein Vorhaben hatte mit dem präsentierten Geschäftsmodell nicht das Geringste zu tun. Haon hatte den Auftrag für die Mission im Traum von einer Macht eingeflüstert bekommen, die aus einem noch ferneren Jenseits stammte, als er selbst. Seine Artgenossen lachten ihn aus, als er vor der gewaltigen Flut einer Zeitströmung warnte, die über die Dimension hereinbrechen und alles vernichten würde. Sollten doch alle ertrinken, aber Haon wollte wenigstens ein Exemplar jeder Götterart im Rumpf seines Weltenschiffes über die Flutkatastrophe retten.
Die Götter waren widerspenstig, und es kostete viel Geduld, bis er einen Vertreter jeder Spezies in die mentalen Käfige seines Weltenschiffs verfrachtet hatte. Besonders Shiva, Allah und ein Zögling namens Jesus waren schwer zu bändigen, gemütliche Gesellen wie Buddha hingegen folgten Haon ohne Murren in den Weltraumsegler, den er auf den Namen Chernobabylon getauft hatte.
Kaum hatte er die letzte Luke geschlossen, brach die in seinem Traum prophezeite Flut über die Dimension herein und überschwemmte jeden Winkel des Universums. Alle Vertreter seiner eigenen Spezies, und auch sämtliche Gottheiten ertranken, während Haon die Segel hisste und auf der stürmischen Gischt der Zeit in eine andere Dimension trieb.
Die Stürme verursachten schwere Schäden am Schiff. Nachdem das letzte Navigationssystem ausgefallen war, strandete Haon mit seiner Götterladung in einem weit abgelegenen Universum, das auf keiner Raumzeitkarte verzeichnet war. Bei der Havarie waren auch die mentalen Käfige der göttlichen Fracht beschädigt worden. Die Insassen ergriffen die Gelegenheit und verfügten sich auf den nächstgelegenen Planeten, wo sie sich im schwach entwickelten Bewusstsein einer niederen Spezies einnisteten und vom Glauben an sich selbst nährten.
Aber ihre Zeit war begrenzt. Die Götter verfügten zwar über eine sehr lange Lebensdauer, entgegen ihrer eigenen Überzeugung waren sie jedoch nicht unsterblich. Haon hatte nicht von jeder Götterart ein zweites Exemplar des anderen Geschlechts in sein Weltenschiff verfrachtet. Bei den wenigen, die sich fortpflanzen konnten, blieben die Nachkommen unfruchtbar, wie im Fall Ganeshas, Shivas und Parvatis Sprössling. Und so starben die letzten Exemplare der Götter auf dem Staubkorn namens Erde irgendwann aus. Sie fanden ihre unbeschrifteten Gräber im kollektiven Vergessen der Menschheit.
Haon gelang es, die Segel der Chernobabylon zu flicken, und seither treibt er ziellos durch die Dimensionen.
Sein Vorhaben hatte mit dem präsentierten Geschäftsmodell nicht das Geringste zu tun. Haon hatte den Auftrag für die Mission im Traum von einer Macht eingeflüstert bekommen, die aus einem noch ferneren Jenseits stammte, als er selbst. Seine Artgenossen lachten ihn aus, als er vor der gewaltigen Flut einer Zeitströmung warnte, die über die Dimension hereinbrechen und alles vernichten würde. Sollten doch alle ertrinken, aber Haon wollte wenigstens ein Exemplar jeder Götterart im Rumpf seines Weltenschiffes über die Flutkatastrophe retten.
Die Götter waren widerspenstig, und es kostete viel Geduld, bis er einen Vertreter jeder Spezies in die mentalen Käfige seines Weltenschiffs verfrachtet hatte. Besonders Shiva, Allah und ein Zögling namens Jesus waren schwer zu bändigen, gemütliche Gesellen wie Buddha hingegen folgten Haon ohne Murren in den Weltraumsegler, den er auf den Namen Chernobabylon getauft hatte.
Kaum hatte er die letzte Luke geschlossen, brach die in seinem Traum prophezeite Flut über die Dimension herein und überschwemmte jeden Winkel des Universums. Alle Vertreter seiner eigenen Spezies, und auch sämtliche Gottheiten ertranken, während Haon die Segel hisste und auf der stürmischen Gischt der Zeit in eine andere Dimension trieb.
Die Stürme verursachten schwere Schäden am Schiff. Nachdem das letzte Navigationssystem ausgefallen war, strandete Haon mit seiner Götterladung in einem weit abgelegenen Universum, das auf keiner Raumzeitkarte verzeichnet war. Bei der Havarie waren auch die mentalen Käfige der göttlichen Fracht beschädigt worden. Die Insassen ergriffen die Gelegenheit und verfügten sich auf den nächstgelegenen Planeten, wo sie sich im schwach entwickelten Bewusstsein einer niederen Spezies einnisteten und vom Glauben an sich selbst nährten.
Aber ihre Zeit war begrenzt. Die Götter verfügten zwar über eine sehr lange Lebensdauer, entgegen ihrer eigenen Überzeugung waren sie jedoch nicht unsterblich. Haon hatte nicht von jeder Götterart ein zweites Exemplar des anderen Geschlechts in sein Weltenschiff verfrachtet. Bei den wenigen, die sich fortpflanzen konnten, blieben die Nachkommen unfruchtbar, wie im Fall Ganeshas, Shivas und Parvatis Sprössling. Und so starben die letzten Exemplare der Götter auf dem Staubkorn namens Erde irgendwann aus. Sie fanden ihre unbeschrifteten Gräber im kollektiven Vergessen der Menschheit.
Haon gelang es, die Segel der Chernobabylon zu flicken, und seither treibt er ziellos durch die Dimensionen.
Dienstag, Oktober 24, 2006
Montag, Oktober 23, 2006
Auf dem Dachboden der vergessenen Gedanken
Während im Hintergrund 4'33 von John Cage lief, war Escher in den lautlosen Tiefen seines Ohrensessels versunken und versuchte, die Zirkelschlüsse auf der Mustertapete zu enträtseln, indem er über die komplexe Geometrie der Formen in die entlegenen Kammern seiner Wahrnehmung kletterte. Dort fand er, mitten in einem Raum aus dunkelblauem Samt, eine Wendeltreppe selten benutzter Nervenbahnen. Laut Beschilderung führte dieser Weg auf den obersten Dachboden seines Gehirns. Das Schild wies zusätzlich darauf hin, dass ein Betreten der Treppe für Unbefugte verboten sei.
Zuerst erschien ihm der Weg riskant, denn an der Treppe war kein Geländer, und die verstaubten Stufen knarrten wie die Planken eines Geisterschiffs, das nach endloser Fahrt am Rand der Zeit gestrandet war. Aber mit jedem Schritt spürte Escher seine Zuversicht steigen. Ungezählte Stufen später schaute er für einen Moment nach unten und glaubte, einen Mann zu erkennen, der ihn aus der Ferne an sein eigenes Spiegelbild erinnerte. Als er sich ein weiteres Mal umdrehte, war die Gestalt verschwunden.
Die Treppe endete vor einer verschlossenen Tür. Reflexartig fasste Escher in seine Hosentasche und zog einen Schlüssel hervor, der ihm fremd erschien. Der Schlüssel war altmodisch, wies aber kaum Gebrauchspuren auf. Es war ein roter Faden daran befestigt, an dessen anderem Ende ein Zettel mit der Aufschrift Schädelspeicher baumelte.
Wie von selbst schien sich der Schlüssel im Schloss zu drehen, und die schwere Tür ließ sich ohne Anstrengung öffnen. Noch bevor Escher über die Schwelle trat, kam ihm der nostalgische Geruch einer Dachkammer entgegen, in der Gedanken lagerten, die er vor langer Zeit dort abgestellt hatte. Es gab keinen Lichtschalter, aber durch die Ritzen im Holz zwischen den Dachbalken drangen schmale Strahlen, in denen der aufgewirbelte Staub tanzte. Mit Hilfe dieses schwachen Lichts konnte er die Gedanken in seiner unmittelbaren Nähe schemenhaft erkennen. Als Escher sich langsam in den Raum vortastete, hörte er, wie hinter ihm die Tür ins Schloss fiel.
Mit verhaltenem Interesse betastete er längst vergessene Gedanken, über die sich eine farblose Patina seiner geistigen Biografie gelegt hatte. Da war ein Gedanken an Tolstoi im Morgenrock, oder an einen uralten Mann im Stadtpark, der sich von Tauben füttern ließ, und dahinter entdeckte Escher eine verstaubte Erinnerung an seine Großmutter, wie sie mit einem Rosenkranz zwischen ihren knochigen Fingern in dem Ohrensessel lehnte, den sie ihm vermacht hatte.
Als er weiter in den Raum vordringen wollte, vernahm er ein Geräusch an der Tür. Escher drehte sich um und sah, wie ein weißer Umschlag durch den Türspalt geschoben wurde. Neugierig ging er zur Tür und hob das Kuvert auf. Es war an ihn adressiert, Herrn Escher persönlich. Der Umschlag enthielt einen Briefbogen mit einer kurzen Nachricht, die in derselben Handschrift wie die Adressierung verfasst war: Zurück, Gefahr! Escher hätte schwören können, dass die winzigen Wörter auf dem Papier seiner eigenen Handschrift entstammten.
Er riss die Tür auf. Und blickte auf die Mustertapete in seinem Wohnzimmer. Beruhigt schloss Escher seine Augen. Es hatte sich nichts verändert. Niemand war da, nur die Musik war zu Ende.
Zuerst erschien ihm der Weg riskant, denn an der Treppe war kein Geländer, und die verstaubten Stufen knarrten wie die Planken eines Geisterschiffs, das nach endloser Fahrt am Rand der Zeit gestrandet war. Aber mit jedem Schritt spürte Escher seine Zuversicht steigen. Ungezählte Stufen später schaute er für einen Moment nach unten und glaubte, einen Mann zu erkennen, der ihn aus der Ferne an sein eigenes Spiegelbild erinnerte. Als er sich ein weiteres Mal umdrehte, war die Gestalt verschwunden.
Die Treppe endete vor einer verschlossenen Tür. Reflexartig fasste Escher in seine Hosentasche und zog einen Schlüssel hervor, der ihm fremd erschien. Der Schlüssel war altmodisch, wies aber kaum Gebrauchspuren auf. Es war ein roter Faden daran befestigt, an dessen anderem Ende ein Zettel mit der Aufschrift Schädelspeicher baumelte.
Wie von selbst schien sich der Schlüssel im Schloss zu drehen, und die schwere Tür ließ sich ohne Anstrengung öffnen. Noch bevor Escher über die Schwelle trat, kam ihm der nostalgische Geruch einer Dachkammer entgegen, in der Gedanken lagerten, die er vor langer Zeit dort abgestellt hatte. Es gab keinen Lichtschalter, aber durch die Ritzen im Holz zwischen den Dachbalken drangen schmale Strahlen, in denen der aufgewirbelte Staub tanzte. Mit Hilfe dieses schwachen Lichts konnte er die Gedanken in seiner unmittelbaren Nähe schemenhaft erkennen. Als Escher sich langsam in den Raum vortastete, hörte er, wie hinter ihm die Tür ins Schloss fiel.
Mit verhaltenem Interesse betastete er längst vergessene Gedanken, über die sich eine farblose Patina seiner geistigen Biografie gelegt hatte. Da war ein Gedanken an Tolstoi im Morgenrock, oder an einen uralten Mann im Stadtpark, der sich von Tauben füttern ließ, und dahinter entdeckte Escher eine verstaubte Erinnerung an seine Großmutter, wie sie mit einem Rosenkranz zwischen ihren knochigen Fingern in dem Ohrensessel lehnte, den sie ihm vermacht hatte.
Als er weiter in den Raum vordringen wollte, vernahm er ein Geräusch an der Tür. Escher drehte sich um und sah, wie ein weißer Umschlag durch den Türspalt geschoben wurde. Neugierig ging er zur Tür und hob das Kuvert auf. Es war an ihn adressiert, Herrn Escher persönlich. Der Umschlag enthielt einen Briefbogen mit einer kurzen Nachricht, die in derselben Handschrift wie die Adressierung verfasst war: Zurück, Gefahr! Escher hätte schwören können, dass die winzigen Wörter auf dem Papier seiner eigenen Handschrift entstammten.
Er riss die Tür auf. Und blickte auf die Mustertapete in seinem Wohnzimmer. Beruhigt schloss Escher seine Augen. Es hatte sich nichts verändert. Niemand war da, nur die Musik war zu Ende.
Labels: Escher
Samstag, Oktober 21, 2006
Nazitube?
a) Ich verliere selten die Contenance.
b) Ich bin kein intensiver Youtube Nutzer.
c) Aber ich bin bekennender Anti-Faschist.
Wenn man Punkt c) berücksichtigt, wird man sich nicht wundern, dass mir heute morgen die Gesichtszüge entgleisten und beinahe in die Kaffeetasse rutschten, als ich ein Video der Neonazi-Band Macht und Ehre auf Youtube entdeckte. Praktischer Weise erhält man gleichzeitig Links zu Videos mit ähnlichen Inhalten angezeigt. Es stellte sich heraus, dass die beliebte Website eine offene Plattform für Neonazi-Bands bietet, u.a. fand ich Videos von Sturmwehr, Race War, Sturm 18, Division Germania, Arisches Blut ...
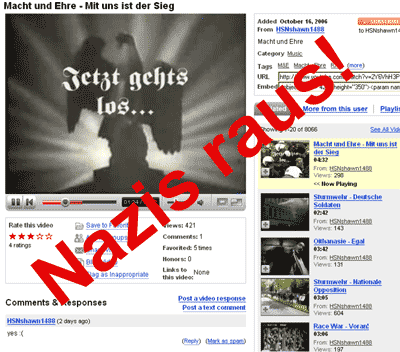
Bei einem Klick auf das Video von Oithanasie erhielt ich folgenden Hinweis:
This video may contain content that is inappropriate for some users, as flagged by YouTube's user community.
Immerhin wird man vor dem Einloggen darauf hingewiesen, dass Teile der YouTube's user community diesen Inhalt für unpassend halten. Trotzdem wundere ich mich, dass es den Betreibern der Plattform offenbar egal ist, ob extreme Hetzvideos über ihre Technologie verbreitet werden. Ansonsten gäbe es eine Kontrollinstanz.
Falls die neonazistischen Inhalte weiterhin auf youtube.com angeboten werden können, schlage ich vor, entsprechende Seiten mit einem neuen Logo zu kennzeichnen:

Ich will keinen Link auf den oben genannten Dreck setzen, die Videos sind über Eingabe der Bandnamen im Suchfeld problemlos erreichbar.
b) Ich bin kein intensiver Youtube Nutzer.
c) Aber ich bin bekennender Anti-Faschist.
Wenn man Punkt c) berücksichtigt, wird man sich nicht wundern, dass mir heute morgen die Gesichtszüge entgleisten und beinahe in die Kaffeetasse rutschten, als ich ein Video der Neonazi-Band Macht und Ehre auf Youtube entdeckte. Praktischer Weise erhält man gleichzeitig Links zu Videos mit ähnlichen Inhalten angezeigt. Es stellte sich heraus, dass die beliebte Website eine offene Plattform für Neonazi-Bands bietet, u.a. fand ich Videos von Sturmwehr, Race War, Sturm 18, Division Germania, Arisches Blut ...
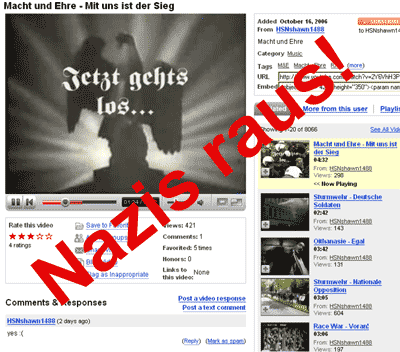
Bei einem Klick auf das Video von Oithanasie erhielt ich folgenden Hinweis:
This video may contain content that is inappropriate for some users, as flagged by YouTube's user community.
Immerhin wird man vor dem Einloggen darauf hingewiesen, dass Teile der YouTube's user community diesen Inhalt für unpassend halten. Trotzdem wundere ich mich, dass es den Betreibern der Plattform offenbar egal ist, ob extreme Hetzvideos über ihre Technologie verbreitet werden. Ansonsten gäbe es eine Kontrollinstanz.
Falls die neonazistischen Inhalte weiterhin auf youtube.com angeboten werden können, schlage ich vor, entsprechende Seiten mit einem neuen Logo zu kennzeichnen:

Ich will keinen Link auf den oben genannten Dreck setzen, die Videos sind über Eingabe der Bandnamen im Suchfeld problemlos erreichbar.
Donnerstag, Oktober 19, 2006
Kür
Ein Sekundenbruchteil jenseits der zeitlichen Messbarkeit entschied über das Ende ihrer Karriere. Damals stand sie auf dem Höhepunkt, kurz vor der Edelmetallernte. Den einsamen Gipfel hatte sie am Ende einer entbehrungsreichen Reise durch die Salzwüste des Kraftraums und über die Leitern der Sprungtürme erklommen. Die Eintrittskarte für den Erfolg bezahlte sie mit den Nachmittagen ihrer Kindheit und Jugend. Das selbstzufriedene, runde Gesicht des Vaters nach einem Turniersieg war der schönste Pokal.
Zehn Meter unter ihr klaffte der aufgerissene Rachen des Beckens. Die Stimmung im Stadion war angespannt wie jeder einzelne Muskel an ihrem austrainierten Körper. Nur der Schlag ihres Herzens hallte zwischen den Tribünen, während sie sich mit den Zehen an der Betonkante festkrallte.
Im Moment des Absprungs wusste sie, dass die Kür misslang. Beim Eintauchen ins eisige Blau spritzte das Wasser zornig in alle Richtungen.
Jetzt stand sie wieder auf dem Turm. Sie wollte es noch einmal versuchen. Wie damals drehte sie sich elegant mit dem Rücken zum Becken und hielt das Gleichgewicht auf der Betonkante. Sie spreizte ihre Arme im rechten Winkel vom Körper, und nachdem sie die Spannung für die richtige Länge des Moments gehalten hatte, stieß sie sich ab. Der Sprung war in seiner Perfektion vollendet, und ein zufällig anwesender Wettkampfrichter hätte die Bestnote gegeben. Ohne Punkteabzug. Aber es war Nacht, und aus der Nacht gab es kein Auftauchen.
Am nächsten Vormittag wollte der Bademeister das Herbstlaub im Becken zusammenkehren. Die Zigarette fiel ihm aus dem Mundwinkel, als er den verrenkten Körper entdeckte. Das angetrocknete Blut der Tochter hatte auf den blauen Kacheln eine bizarre Grafik hinterlassen. Das Muster erinnerte ihn an den Rorschach-Test, den man vor seiner Verurteilung in der fernen Stadt mit ihm durchgeführt hatte. Damals.
Kurz vor der Bestattungszeremonie fiel ein Platzregen aus den Wolken, und in der Grube glänzte braunes Wasser, als die Träger den Sarg langsam hinabließen.
Zehn Meter unter ihr klaffte der aufgerissene Rachen des Beckens. Die Stimmung im Stadion war angespannt wie jeder einzelne Muskel an ihrem austrainierten Körper. Nur der Schlag ihres Herzens hallte zwischen den Tribünen, während sie sich mit den Zehen an der Betonkante festkrallte.
Im Moment des Absprungs wusste sie, dass die Kür misslang. Beim Eintauchen ins eisige Blau spritzte das Wasser zornig in alle Richtungen.
Jetzt stand sie wieder auf dem Turm. Sie wollte es noch einmal versuchen. Wie damals drehte sie sich elegant mit dem Rücken zum Becken und hielt das Gleichgewicht auf der Betonkante. Sie spreizte ihre Arme im rechten Winkel vom Körper, und nachdem sie die Spannung für die richtige Länge des Moments gehalten hatte, stieß sie sich ab. Der Sprung war in seiner Perfektion vollendet, und ein zufällig anwesender Wettkampfrichter hätte die Bestnote gegeben. Ohne Punkteabzug. Aber es war Nacht, und aus der Nacht gab es kein Auftauchen.
Am nächsten Vormittag wollte der Bademeister das Herbstlaub im Becken zusammenkehren. Die Zigarette fiel ihm aus dem Mundwinkel, als er den verrenkten Körper entdeckte. Das angetrocknete Blut der Tochter hatte auf den blauen Kacheln eine bizarre Grafik hinterlassen. Das Muster erinnerte ihn an den Rorschach-Test, den man vor seiner Verurteilung in der fernen Stadt mit ihm durchgeführt hatte. Damals.
Kurz vor der Bestattungszeremonie fiel ein Platzregen aus den Wolken, und in der Grube glänzte braunes Wasser, als die Träger den Sarg langsam hinabließen.
Mittwoch, Oktober 18, 2006
Der größte Quatsch aller Zeiten #6

Liebe Bundeswehr, dass du gerne mal was zerstörst, liegt in der Natur der Sache und ist unter Armeen kein Phänomen mit Seltenheitswert. Und dass du deine Mitarbeiter geistig nur für begrenzt funktionsfähig hälst, hat sich aufgrund der niedrigen Geheimhaltungsstufe inzwischen auch herumgesprochen.
Aber dass du dein nicht zu zerstörendes Inventar besonders kennzeichnest, ist eine geniale Innovation im Sinne des Steuerzahlers, denn der zivile Durchschnittsbürger würde die massive Holzkiste mit den Eisenbeschlägen im Regelfall für eine Einwegverpackung halten und nach dem Öffnen umgehend zerstören. Hoffentlich können deine Mitarbeiter wenigstens einigermaßen lesen.
Montag, Oktober 16, 2006
1987 (Teil 3/3)
Anfang September beschlossen A. und ich, unsere Reise fortzusetzen. Wir bereiteten unsere Abschlussparty vor, indem wir Wodka, Zitronenplörre und Feuerholz besorgten. Es war ein rauschendes Fest. Einer der Höhepunkte war, als unsere Gäste den Innenwänden der barackenähnlichen Behausung mit Hilfe von Filzstiften zu neuem Glanz verhalfen. Bereits die früheren Bewohner unseres Zimmers hatten Sprüche und Bilder hinterlassen. Wir empfanden die Zeichnungen als ästhetische Bereicherung, da in dem Raum bereits die Farbe von den Wänden blätterte.
Am nächsten Vormittag standen wir in R.´s Büro, um uns zu verabschieden. Sie eröffnete uns in einem harschen Ton, der keine Widerrede zulassen sollte, dass wir den Kibbuz verlassen könnten, nachdem wir unser Zimmer gestrichen hätten. Die Farbe stünde schon bereit. Darauf waren wir nicht gefasst, denn erstens war das Zimmer offensichtlich auch von unseren Vorgängern nicht gestrichen worden, und zweitens wäre es schade um die schönen Zeichnungen gewesen. Drittens passte mir der Befehlston nicht, zumal das Arbeitsverhältnis sowieso beendet war. Wenn sie die Aufgabe in einem halbwegs freundlichen Ton zur Sprache gebracht hätte, wäre es zu keinem Konflikt gekommen. Ich streiche gerne Wände weiß. Aber es folgte eine heftige Auseinandersetzung, in deren Verlauf ich mich immer stärker auf den Standpunkt zurückzog, das Zimmer unter keinen Umständen zu streichen. Ich wunderte mich darüber, dass A. die Diskussion ausgesprochen ruhig verfolgte. Irgendwann meinte er:
- R., you really ask us to paint the room?
- That´s what I said.
- You ask us to paint all the room?
- Yes.
- The whole room? White?
- Exactly, the whole room. Of course.
- No problem.
R´s Gesicht hellte sich triumphierend auf, und ich fragte A., ob der Wodka seinen Verstand zersetzt hätte. Ich erklärte ihm fassungslos, dass ich das Zimmer auf keinen Fall streichen würde. Es gelang ihm aber, mich zu beschwichtigen, und als wir zurück an der Baracke waren, standen dort bereits zwei Farbeimer und Pinsel vor der Tür. Wortlos nahm A. einen der Eimer und betrat das Zimmer. Ich verfluchte den Weg des geringsten Widerstands. Mit dem zweiten Eimer in der Hand folgte ich ihm und begann, eine Wand zu streichen. Nach einigen Pinselstrichen drehte ich mich um und sah, dass A. mit dem Streichen der durchgelegenen Matratze zugange war. Einen Teil des Bodens hatte er auch schon gestrichen.
Was tat dieser Irre? Sein Hirn schwamm offenbar tatsächlich in einer Wodka-Lemon-Marinade. Ich war endgültig davon überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte.
- Darf man erfahren, welche Drogen vor mir geheim gehalten wurden?
- Ich tue nur, wozu man mich aufgefordert hat. Die Ex-Chefin sagte, wir sollen den ganzen Raum weiß streichen. The whole room. Right?
A. war weder wahnsinnig geworden, noch stand er unter dem Einfluss atropinhaltiger Substanzen. Er hatte R. beim Wort genommen und damit begonnen, den ganzen Raum weiß zu streichen, einschließlich der wenigen Einrichtungsgegenstände.
Wir hatten einen Riesenspaß beim streichen des ganzen Zimmers. Leider konnten wir dann doch nicht den ganzen Raum streichen, da man uns zu wenig Farbe zur Verfügung gestellt hatte. Nach dem letzten Pinselstrich betrachteten wir unser Werk zufrieden und überlegten kurz, ob wir weitere Farbe bestellen sollten. Dann schnappten wir die Seesäcke und ergriffen die Flucht.
Anschließend waren wir noch in Tel Aviv und in Jerusalem, wurden aber nie das Gefühl los, dass man uns beobachtete. An der Grenze zu Ägypten wunderten wir uns, warum man uns nicht spätestens hier festnahm und in einen Kerker verfrachtete.
Wir fuhren weiter nach Kairo und von dort nach Oberägypten. Ende September saßen wir zum ersten Mal im Leben in einem Flugzeug.
Im Oktober trat ich meinen Zivildienst an, und A. wurde zum Militär eingezogen.
Am nächsten Vormittag standen wir in R.´s Büro, um uns zu verabschieden. Sie eröffnete uns in einem harschen Ton, der keine Widerrede zulassen sollte, dass wir den Kibbuz verlassen könnten, nachdem wir unser Zimmer gestrichen hätten. Die Farbe stünde schon bereit. Darauf waren wir nicht gefasst, denn erstens war das Zimmer offensichtlich auch von unseren Vorgängern nicht gestrichen worden, und zweitens wäre es schade um die schönen Zeichnungen gewesen. Drittens passte mir der Befehlston nicht, zumal das Arbeitsverhältnis sowieso beendet war. Wenn sie die Aufgabe in einem halbwegs freundlichen Ton zur Sprache gebracht hätte, wäre es zu keinem Konflikt gekommen. Ich streiche gerne Wände weiß. Aber es folgte eine heftige Auseinandersetzung, in deren Verlauf ich mich immer stärker auf den Standpunkt zurückzog, das Zimmer unter keinen Umständen zu streichen. Ich wunderte mich darüber, dass A. die Diskussion ausgesprochen ruhig verfolgte. Irgendwann meinte er:
- R., you really ask us to paint the room?
- That´s what I said.
- You ask us to paint all the room?
- Yes.
- The whole room? White?
- Exactly, the whole room. Of course.
- No problem.
R´s Gesicht hellte sich triumphierend auf, und ich fragte A., ob der Wodka seinen Verstand zersetzt hätte. Ich erklärte ihm fassungslos, dass ich das Zimmer auf keinen Fall streichen würde. Es gelang ihm aber, mich zu beschwichtigen, und als wir zurück an der Baracke waren, standen dort bereits zwei Farbeimer und Pinsel vor der Tür. Wortlos nahm A. einen der Eimer und betrat das Zimmer. Ich verfluchte den Weg des geringsten Widerstands. Mit dem zweiten Eimer in der Hand folgte ich ihm und begann, eine Wand zu streichen. Nach einigen Pinselstrichen drehte ich mich um und sah, dass A. mit dem Streichen der durchgelegenen Matratze zugange war. Einen Teil des Bodens hatte er auch schon gestrichen.
Was tat dieser Irre? Sein Hirn schwamm offenbar tatsächlich in einer Wodka-Lemon-Marinade. Ich war endgültig davon überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte.
- Darf man erfahren, welche Drogen vor mir geheim gehalten wurden?
- Ich tue nur, wozu man mich aufgefordert hat. Die Ex-Chefin sagte, wir sollen den ganzen Raum weiß streichen. The whole room. Right?
A. war weder wahnsinnig geworden, noch stand er unter dem Einfluss atropinhaltiger Substanzen. Er hatte R. beim Wort genommen und damit begonnen, den ganzen Raum weiß zu streichen, einschließlich der wenigen Einrichtungsgegenstände.
Wir hatten einen Riesenspaß beim streichen des ganzen Zimmers. Leider konnten wir dann doch nicht den ganzen Raum streichen, da man uns zu wenig Farbe zur Verfügung gestellt hatte. Nach dem letzten Pinselstrich betrachteten wir unser Werk zufrieden und überlegten kurz, ob wir weitere Farbe bestellen sollten. Dann schnappten wir die Seesäcke und ergriffen die Flucht.
Anschließend waren wir noch in Tel Aviv und in Jerusalem, wurden aber nie das Gefühl los, dass man uns beobachtete. An der Grenze zu Ägypten wunderten wir uns, warum man uns nicht spätestens hier festnahm und in einen Kerker verfrachtete.
Wir fuhren weiter nach Kairo und von dort nach Oberägypten. Ende September saßen wir zum ersten Mal im Leben in einem Flugzeug.
Im Oktober trat ich meinen Zivildienst an, und A. wurde zum Militär eingezogen.
Samstag, Oktober 14, 2006
1987 (Teil 2/3)
Abseits der hübschen Häuser, in denen die Kibbuzniks wohnten, gab es mehrere schlichte Gebäude auf dem Kibbuzgelände, und in jedem waren sechs bis acht Volunteers in Zimmern mit jeweils zwei Betten untergebracht. Der heruntergekommene Zustand der Zimmer und der Matratzen störte uns nicht, wir hatten in den vergangenen Monaten jenes Sommers an weitaus schlimmeren Stellen geschlafen. Da waren die Straßengräben am Autoput im damaligen Jugoslawien, Abbruchhäuser am Rand von Thessaloniki, Strände mit verwilderten Hunden an der türkischen Schwarzmeerküste, oder die Hafenmauer im syrischen Lattakia.
Am besten gefiel uns die Internationalität der anderen Volunteers im Kibbuz. Mit einem Engländer namens Tony, der in Begleitung seiner Flamme Joan unterwegs war, verstand ich mich besonders gut. Ausgerechnet mit ihm hatte ich anfangs Schwierigkeiten, denn ich begriff erst nach einer Weile, dass es sich bei seinem provokativen Gehabe lediglich um die liebenswürdige Großmäuligkeit handelte, die man in Teilen der englischen Bevölkerung findet. Was ich zunächst als aggressive Herausforderung aufgefasst hatte, war eigentlich als Sympathiebekundung gemeint. Später hatten wir viel Spaß daran, uns während der Arbeit neue Schimpfwörter auszudenken und gegenseitig an den Kopf zu werfen.
Außer an Tony erinnere ich mich noch gut an Wim, der zusammen mit seiner Freundin Mareike in Maanit gelandet war und von Israel aus weiter nach Australien wollte. Wim verweigerte sich aus Überzeugung seinen staatsbürgerlichen Pflichten und wurde in den Niederlanden wegen Fahnenflucht polizeilich gesucht. Weil er die Zeit des Militärdienstes nicht im Gefängnis verbringen wollte, hatte er beschlossen, nie wieder in seine Heimat zurückzukehren.
Sarah, eine schweigsame Irin, trug immer ein Messer am Gürtel. Sie war ein düsterer Typ und sehr trinkfest. Eines Tages wurde sie aufgefordert, den Kibbuz sofort zu verlassen. Den Grund dafür wollte sie uns nicht nennen, und auch R. äußerte sich nicht zu dem Thema. Sarah ging ohne Abschied.
Die Arbeit im Kibbuz gefiel uns. A. und ich waren dazu eingeteilt, einem der Gärtner bei der Pflege der Grünflächen zwischen den Gebäuden zu helfen. Da man es während der Mittagshitze in der Sonne - auch ohne körperliche Betätigung - kaum aushielt, mussten wir sehr früh aufstehen. Dafür war der Arbeitstag am frühen Nachmittag beendet, und man konnte den Rest des Tages am Pool herumlungern oder sich mit anderen lasziven Tätigkeiten beschäftigen.
Gut gefielen uns auch die drei regelmäßigen Mahlzeiten täglich. Zusätzlich erhielt man ein kleines Taschengeld, das in eine Gemeinschaftskasse wanderte und anschließend in Wodka investiert wurde. Zur Organisation des Wodkas wurden wöchentlich kleine Komitees gebildet, die aus zwei Leuten bestanden und per Autostop ins nahe gelegene Hadera fuhren. Dort besorgte man den Fusel in einem Supermarkt und trampte anschließend, mit Flaschen bepackt, zurück nach Maanit. Eine höchst vertrauensvolle Aufgabe. Weil man das billige Zeug pur kaum durch den Hals bekam, wurde in einem kleinen Laden, der zum Kibbuz gehörte, eine Art Zitronenlimonade zum Verdünnen gekauft. Auf diese Weise war man, neben dem regelmäßigen Essen, auch mit einer regelmäßigen Getränkezufuhr versorgt.
Da es ansonsten wenig Ablenkung gab, musste jeden Tag ein Anlass für eine Party gefunden werden. Dieses Problem war leicht zu lösen, dauernd gab es Willkommens-, Abschieds-, Geburtstags-, Vollmond-, und sonstige Parties. Dabei blieben die Volunteers unter sich. Überhaut lernte man, über die nötigen Kontakte während der Arbeit hinaus, kaum einen Kibbuznik kennen. Die Erkärung dafür war einfach. Es trafen ständig Leute aus aller Welt ein, um für einige Wochen oder wenige Monate im Kibbuz zu leben. Die Israelis wussten, dass engere Bindungen aufgrund der befristeten Aufenthalte keinen Sinn machten, und investierten daher kaum Zeit in Bekanntschaften mit den Fremden.
Dann erfuhren wir, dass sich eine Bewohnerin des Kibbuz mit uns treffen wollte. Es handelte sich um eine alte Frau, die der Vernichtung in Deutschland entkommen war. Seither hatte sie ihre Muttersprache Deutsch nicht mehr gesprochen. Sie lud uns in ihr Haus ein, wir tranken gemeinsam Tee und unterhielten uns über unverfängliche Dinge. Sie sprach vollkommen akzentfrei deutsch. Obwohl die alte Frau sehr freundlich war, und sich aufrichtig über unseren Besuch zu freuen schien, empfanden wir die Atmosphäre als beklemmend, da man uns während der Schulzeit erfolgreich das zwischen den Zeilen des Lehrplans vorgeschriebene Maß an Schuldbewusstsein eingetrichtert hatte. Über diesen Besuch haben A. und ich später nie wieder geredet.
Wenige Tage nach Sarahs Entlassung wurde der Russe Karim gefeuert. Karim war erst wenige Monate zuvor aus Russland über die finnische Grenze geflüchtet und hatte sich anschließend durch Mittel- und Südeuropa bis nach Israel durchgeschlagen. Auch in seinem Fall erfuhren wir den Grund für die Entlassung nicht. Aber man hatte das Gefühl, dass R. mehr über ihre Volunteers wusste, als manchen recht war.
--
Fortsetzung morgen
Am besten gefiel uns die Internationalität der anderen Volunteers im Kibbuz. Mit einem Engländer namens Tony, der in Begleitung seiner Flamme Joan unterwegs war, verstand ich mich besonders gut. Ausgerechnet mit ihm hatte ich anfangs Schwierigkeiten, denn ich begriff erst nach einer Weile, dass es sich bei seinem provokativen Gehabe lediglich um die liebenswürdige Großmäuligkeit handelte, die man in Teilen der englischen Bevölkerung findet. Was ich zunächst als aggressive Herausforderung aufgefasst hatte, war eigentlich als Sympathiebekundung gemeint. Später hatten wir viel Spaß daran, uns während der Arbeit neue Schimpfwörter auszudenken und gegenseitig an den Kopf zu werfen.
Außer an Tony erinnere ich mich noch gut an Wim, der zusammen mit seiner Freundin Mareike in Maanit gelandet war und von Israel aus weiter nach Australien wollte. Wim verweigerte sich aus Überzeugung seinen staatsbürgerlichen Pflichten und wurde in den Niederlanden wegen Fahnenflucht polizeilich gesucht. Weil er die Zeit des Militärdienstes nicht im Gefängnis verbringen wollte, hatte er beschlossen, nie wieder in seine Heimat zurückzukehren.
Sarah, eine schweigsame Irin, trug immer ein Messer am Gürtel. Sie war ein düsterer Typ und sehr trinkfest. Eines Tages wurde sie aufgefordert, den Kibbuz sofort zu verlassen. Den Grund dafür wollte sie uns nicht nennen, und auch R. äußerte sich nicht zu dem Thema. Sarah ging ohne Abschied.
Die Arbeit im Kibbuz gefiel uns. A. und ich waren dazu eingeteilt, einem der Gärtner bei der Pflege der Grünflächen zwischen den Gebäuden zu helfen. Da man es während der Mittagshitze in der Sonne - auch ohne körperliche Betätigung - kaum aushielt, mussten wir sehr früh aufstehen. Dafür war der Arbeitstag am frühen Nachmittag beendet, und man konnte den Rest des Tages am Pool herumlungern oder sich mit anderen lasziven Tätigkeiten beschäftigen.
Gut gefielen uns auch die drei regelmäßigen Mahlzeiten täglich. Zusätzlich erhielt man ein kleines Taschengeld, das in eine Gemeinschaftskasse wanderte und anschließend in Wodka investiert wurde. Zur Organisation des Wodkas wurden wöchentlich kleine Komitees gebildet, die aus zwei Leuten bestanden und per Autostop ins nahe gelegene Hadera fuhren. Dort besorgte man den Fusel in einem Supermarkt und trampte anschließend, mit Flaschen bepackt, zurück nach Maanit. Eine höchst vertrauensvolle Aufgabe. Weil man das billige Zeug pur kaum durch den Hals bekam, wurde in einem kleinen Laden, der zum Kibbuz gehörte, eine Art Zitronenlimonade zum Verdünnen gekauft. Auf diese Weise war man, neben dem regelmäßigen Essen, auch mit einer regelmäßigen Getränkezufuhr versorgt.
Da es ansonsten wenig Ablenkung gab, musste jeden Tag ein Anlass für eine Party gefunden werden. Dieses Problem war leicht zu lösen, dauernd gab es Willkommens-, Abschieds-, Geburtstags-, Vollmond-, und sonstige Parties. Dabei blieben die Volunteers unter sich. Überhaut lernte man, über die nötigen Kontakte während der Arbeit hinaus, kaum einen Kibbuznik kennen. Die Erkärung dafür war einfach. Es trafen ständig Leute aus aller Welt ein, um für einige Wochen oder wenige Monate im Kibbuz zu leben. Die Israelis wussten, dass engere Bindungen aufgrund der befristeten Aufenthalte keinen Sinn machten, und investierten daher kaum Zeit in Bekanntschaften mit den Fremden.
Dann erfuhren wir, dass sich eine Bewohnerin des Kibbuz mit uns treffen wollte. Es handelte sich um eine alte Frau, die der Vernichtung in Deutschland entkommen war. Seither hatte sie ihre Muttersprache Deutsch nicht mehr gesprochen. Sie lud uns in ihr Haus ein, wir tranken gemeinsam Tee und unterhielten uns über unverfängliche Dinge. Sie sprach vollkommen akzentfrei deutsch. Obwohl die alte Frau sehr freundlich war, und sich aufrichtig über unseren Besuch zu freuen schien, empfanden wir die Atmosphäre als beklemmend, da man uns während der Schulzeit erfolgreich das zwischen den Zeilen des Lehrplans vorgeschriebene Maß an Schuldbewusstsein eingetrichtert hatte. Über diesen Besuch haben A. und ich später nie wieder geredet.
Wenige Tage nach Sarahs Entlassung wurde der Russe Karim gefeuert. Karim war erst wenige Monate zuvor aus Russland über die finnische Grenze geflüchtet und hatte sich anschließend durch Mittel- und Südeuropa bis nach Israel durchgeschlagen. Auch in seinem Fall erfuhren wir den Grund für die Entlassung nicht. Aber man hatte das Gefühl, dass R. mehr über ihre Volunteers wusste, als manchen recht war.
--
Fortsetzung morgen
1987 (Teil 1/3)
Nach drei Wochen in glühenden Gewächshäusern, die einem zypriotischen Tomatenzüchter gehörten, bestiegen wir in Limassol eine Fähre nach Haifa. Der Zypriot hatte die Lust verloren, uns zu bezahlen, weil wir in der Dorfkneipe unangenehm aufgefallen waren. Es war Mitte Juli, wir hatten großen Durst.
Auf dem Deck des Schiffes erzählte ein Ire von den israelischen Kibbuzim und gab uns die Adresse eines Vermittlungsbüros in Tel Aviv.
Der zerbeulte Pritschenwagen sammelte uns an der Straße kurz hinter dem Hafen auf, wo wir unsere Handrücken sonnten. In Israel trampte man nicht mit dem Daumen, sondern bewegte die zur Straße zeigende Handfläche auf und ab. Zwei orthodoxe Juden mit langen Bärten und Schläfenlocken wurden zornig, weil der Fahrer sie nicht mitnehmen wollte. Durch die Staubwolke der durchdrehenden Reifen riefen sie uns Worte auf Hebräisch hinterher, die sehr unfreundlich klangen.
Erbarmungslos brannte die israelische Hitze auf die Ladefläche, und wir zogen unsere Schildmützen tief ins Gesicht. Der Beifahrer hatte das hintere Fenster geöffnet und stellte in gebrochenem Englisch die üblichen Fragen. Als er hörte, warum wir nach Tel Aviv trampten, lachte er und meinte, den Umweg könnten wir uns sparen. Die beiden waren Kibbuzniks und nahmen uns mit nach Maanit.
Maanit war eine grüne Insel inmitten des Staubs. Aber eigentlich war ganz Israel eine grüne Insel im Vergleich zu Syrien. Damals bewunderten wir die Tüchtigkeit der Israelis und verschwendeten keine Gedanken an die Quellen des Wassers und des Geldes, das für die Begrünung benötigt wurde.
Die beiden aus dem Pickup brachten uns zu R., die für die Einteilung ausländischer Hilfskräfte zuständig war. Sie wurde offiziell als Volunteers Leader bezeichnet. R. fragte, woher wir kamen, und als sie erfuhr, dass wir Deutsche waren, runzelte sie die Stirn. Sie sagte, wir seien die ersten Deutschen, die nach einem Job in Maanit fragten. Dieser Kibbuz war einer der ältesten in Israel. Es lebten dort viele Kibbuzniks, die den Holocaust überlebt hatten. Mein Gesinnungsgenosse A. und ich sahen uns an, erhoben uns von den Stühlen, die man uns angeboten hatte, und schulterten unsere Seesäcke.
R. meinte, wir sollten nichts überstürzen. Sie benötigte noch Arbeitskräfte für die Gärten, und sie wollte mit dem Verwaltungsrat des Kibbuz klären, ob sie uns einstellen durfte.
Wir setzten uns wieder und ließen uns vom Ventilator in R´s Büro hypnotisieren, bis sie nach einer Stunde zurückkam und mit einem Lächeln erklärte, dass wir zur Probe eingestellt seien.
--
Fortsetzung morgen
Auf dem Deck des Schiffes erzählte ein Ire von den israelischen Kibbuzim und gab uns die Adresse eines Vermittlungsbüros in Tel Aviv.
Der zerbeulte Pritschenwagen sammelte uns an der Straße kurz hinter dem Hafen auf, wo wir unsere Handrücken sonnten. In Israel trampte man nicht mit dem Daumen, sondern bewegte die zur Straße zeigende Handfläche auf und ab. Zwei orthodoxe Juden mit langen Bärten und Schläfenlocken wurden zornig, weil der Fahrer sie nicht mitnehmen wollte. Durch die Staubwolke der durchdrehenden Reifen riefen sie uns Worte auf Hebräisch hinterher, die sehr unfreundlich klangen.
Erbarmungslos brannte die israelische Hitze auf die Ladefläche, und wir zogen unsere Schildmützen tief ins Gesicht. Der Beifahrer hatte das hintere Fenster geöffnet und stellte in gebrochenem Englisch die üblichen Fragen. Als er hörte, warum wir nach Tel Aviv trampten, lachte er und meinte, den Umweg könnten wir uns sparen. Die beiden waren Kibbuzniks und nahmen uns mit nach Maanit.
Maanit war eine grüne Insel inmitten des Staubs. Aber eigentlich war ganz Israel eine grüne Insel im Vergleich zu Syrien. Damals bewunderten wir die Tüchtigkeit der Israelis und verschwendeten keine Gedanken an die Quellen des Wassers und des Geldes, das für die Begrünung benötigt wurde.
Die beiden aus dem Pickup brachten uns zu R., die für die Einteilung ausländischer Hilfskräfte zuständig war. Sie wurde offiziell als Volunteers Leader bezeichnet. R. fragte, woher wir kamen, und als sie erfuhr, dass wir Deutsche waren, runzelte sie die Stirn. Sie sagte, wir seien die ersten Deutschen, die nach einem Job in Maanit fragten. Dieser Kibbuz war einer der ältesten in Israel. Es lebten dort viele Kibbuzniks, die den Holocaust überlebt hatten. Mein Gesinnungsgenosse A. und ich sahen uns an, erhoben uns von den Stühlen, die man uns angeboten hatte, und schulterten unsere Seesäcke.
R. meinte, wir sollten nichts überstürzen. Sie benötigte noch Arbeitskräfte für die Gärten, und sie wollte mit dem Verwaltungsrat des Kibbuz klären, ob sie uns einstellen durfte.
Wir setzten uns wieder und ließen uns vom Ventilator in R´s Büro hypnotisieren, bis sie nach einer Stunde zurückkam und mit einem Lächeln erklärte, dass wir zur Probe eingestellt seien.
--
Fortsetzung morgen
Donnerstag, Oktober 12, 2006
XooYooZoo
- Wir müssen ihnen artgerechtes Futter besorgen. Sie scheinen den Schuppenschleim nicht zu vertragen, es sind schon wieder zwei verendet.
- Machen Sie sich keine Sorgen, Y8, die Viecher sind anpassungsfähig. Die werden sich an das Futter gewöhnen, so wie sie sich auch an das Klima und die Zusammensetzung der Atemluft innerhalb unserer Atmosphäre gewöhnt haben. Sie scheinen sich in ihrem Gehege gut einzuleben.
Zoodirektor 3st grunzte und tippte mit seinem angespitzten Außendorn gegen das Panzerglas. Die Wesen blinzelten kurz in die Richtung des Direktors und seines leitenden Tierpflegers. In den Augen der Exoten war keine Angst, sondern Neugier zu erkennen.
- Außerdem haben wir noch genügend Exemplare. Man darf es nicht zu laut sagen, wegen den Artenschützern, aber es wäre zu kostspielig, einen Planeten ausfindig zu machen, auf dem ähnliche Vegetationsbedingungen herrschen wie auf dem Heimatplaneten dieser Spezies - nur um artgerechtes Futter zu besorgen.
Gedankenverloren wischte Y8 einen Schleimklumpen von dem Schild am Gehege, das zur Information der Zoobesucher diente. Er steckte den Schleim in eine seiner zahlreichen Körperöffnungen und erzeugte ein schlürfendes Geräusch. Auf der schwarzen Metallplakette war zu lesen:
Mensch
Erfolgreichste Art in einem abgelegenen Sonnensystem der ansonsten unbelebten Galaxie Milchgosse, gehörte dort zu den Säugetieren, niederen organischen Lebensformen, die sich durch ausgeprägte soziale Netze und Anpassungsfähigkeit an extreme Existenzbedingungen auszeichneten. Der Herkunftsplanet Erde wurde während der vierten großen Energiekrise eingeschmolzen und zu einem Raumtransporter mittlerer Größe verarbeitet, der im Containerverkehr zwischen den äußeren XooYoo Trabanten kreuzt.
Bevor die XooYoo den Planeten Erde recycelt haben, fingen sie einige Exemplare der am weitesten verbreiteten Spezies für ihren Zoo ein. Sie taten das auf jedem bewohnten Planeten, bevor sie ihn weiterverarbeiteten. Den entschlüsselten Schriftstücken entnahmen die XooYoo, dass sich die Angehörigen der Spezies selbst als Menschen bezeichneten.
Die XooYoo zeichneten sich durch ihren unstillbaren Hunger nach Erkenntnis aus. Nichts erschien ihnen zu unbedeutend, um auf wissenschaftliche Untersuchungen zu verzichten. Das wurde ihnen zum Verhängnis.
Sehr lange Zeit später landete auf XooYoo ein außerxooyooisches Volk während einer Expeditionsreise. Für den heimischen Zoo nahmen sie einige Exemplare der auf XooYoo am weitesten verbreiteten Art mit. Auf dem Schild am Gehege wurde die Spezies als Xooyooaner gekennzeichnet.
Tatsächlich handelte es sich um Nachfahren der weißen Laborratten von der Erde, die im XooYooZoo irrtümlicher Weise für Menschen gehalten worden waren.
- Machen Sie sich keine Sorgen, Y8, die Viecher sind anpassungsfähig. Die werden sich an das Futter gewöhnen, so wie sie sich auch an das Klima und die Zusammensetzung der Atemluft innerhalb unserer Atmosphäre gewöhnt haben. Sie scheinen sich in ihrem Gehege gut einzuleben.
Zoodirektor 3st grunzte und tippte mit seinem angespitzten Außendorn gegen das Panzerglas. Die Wesen blinzelten kurz in die Richtung des Direktors und seines leitenden Tierpflegers. In den Augen der Exoten war keine Angst, sondern Neugier zu erkennen.
- Außerdem haben wir noch genügend Exemplare. Man darf es nicht zu laut sagen, wegen den Artenschützern, aber es wäre zu kostspielig, einen Planeten ausfindig zu machen, auf dem ähnliche Vegetationsbedingungen herrschen wie auf dem Heimatplaneten dieser Spezies - nur um artgerechtes Futter zu besorgen.
Gedankenverloren wischte Y8 einen Schleimklumpen von dem Schild am Gehege, das zur Information der Zoobesucher diente. Er steckte den Schleim in eine seiner zahlreichen Körperöffnungen und erzeugte ein schlürfendes Geräusch. Auf der schwarzen Metallplakette war zu lesen:
Mensch
Erfolgreichste Art in einem abgelegenen Sonnensystem der ansonsten unbelebten Galaxie Milchgosse, gehörte dort zu den Säugetieren, niederen organischen Lebensformen, die sich durch ausgeprägte soziale Netze und Anpassungsfähigkeit an extreme Existenzbedingungen auszeichneten. Der Herkunftsplanet Erde wurde während der vierten großen Energiekrise eingeschmolzen und zu einem Raumtransporter mittlerer Größe verarbeitet, der im Containerverkehr zwischen den äußeren XooYoo Trabanten kreuzt.
Bevor die XooYoo den Planeten Erde recycelt haben, fingen sie einige Exemplare der am weitesten verbreiteten Spezies für ihren Zoo ein. Sie taten das auf jedem bewohnten Planeten, bevor sie ihn weiterverarbeiteten. Den entschlüsselten Schriftstücken entnahmen die XooYoo, dass sich die Angehörigen der Spezies selbst als Menschen bezeichneten.
Die XooYoo zeichneten sich durch ihren unstillbaren Hunger nach Erkenntnis aus. Nichts erschien ihnen zu unbedeutend, um auf wissenschaftliche Untersuchungen zu verzichten. Das wurde ihnen zum Verhängnis.
Sehr lange Zeit später landete auf XooYoo ein außerxooyooisches Volk während einer Expeditionsreise. Für den heimischen Zoo nahmen sie einige Exemplare der auf XooYoo am weitesten verbreiteten Art mit. Auf dem Schild am Gehege wurde die Spezies als Xooyooaner gekennzeichnet.
Tatsächlich handelte es sich um Nachfahren der weißen Laborratten von der Erde, die im XooYooZoo irrtümlicher Weise für Menschen gehalten worden waren.
Mittwoch, Oktober 11, 2006
Ein Porsche in Tarnfarben (XVII)
Von Breuer verhielt sich unauffällig, die einzigen Äußerungen während seiner Aufenthalte in der Bar bestanden in der üblichen Bestellung und einem tonlosen Dank u wel, wenn der Kellner die Flasche Genever auf den Tisch stellte. Am ersten Abend hatte Henk dem Personal die Anweisung erteilt, dass die Rechnung des Deutschen aufs Haus gehen sollte. Als der Kellner, nach der Rechnung gefragt, dem Offizier mitteilte, dass er die entstandene Summe als bereits beglichen betrachten möge, bestand von Breuer mit einem kaum erkennbaren, verächtlichen Zug um den Mundwinkel darauf, den Betrag selbst zu bezahlen. Um-ge-hend. Die dritte Silbe zischte er wie einen Schlag mit der Reitpeitsche durch aufeinander gepresste Zahnreihen.
Nachdem er ihn einige Abende beobachtet hatte, wirkte von Breuer auf Henk wie einer, der nichts mehr vom Leben erwartete und versehentlich in einen Krieg verwickelt war, der ihn nicht interessierte. Henk Noorlander glaubte, der unauffällig betrunkene Mann in der dunklen Ecke des Hamsterradjes suchte nur eine Zuflucht vor dem Alltag des Größenwahns, und fast wurde ihm der schweigsame Mann sympathisch. Henk Noorlander täuschte sich.
Anfangs verbreitete der Deutsche mit seiner lautlosen Anwesenheit eine Atmosphäre, in der die Raumtemperatur zu sinken schien. Aber eine gleichzeitig schützende und gefährliche Veranlagung sorgt dafür, dass sich die Menschen schnell an Situationen gewöhnen, die sie in einer ersten Konfrontation als bedrohlich empfanden. Wenn der Zustand einer Bedrohung durch unveränderte Wiederholungen zum Gemälde erstarrt, wird die Situation irgendwann zum Inventar der gewohnten Umgebung.
In der Wahrnehmung der Stammgäste wandelte sich von Breuer vom Gesandten eines verhassten Systems zu einem überflüssigen Einrichtungsgegenstand, dem man irgendwann keine Beachtung mehr schenkte. Aber auch Henk Noorlanders Gäste täuschten sich.
Nachdem er ihn einige Abende beobachtet hatte, wirkte von Breuer auf Henk wie einer, der nichts mehr vom Leben erwartete und versehentlich in einen Krieg verwickelt war, der ihn nicht interessierte. Henk Noorlander glaubte, der unauffällig betrunkene Mann in der dunklen Ecke des Hamsterradjes suchte nur eine Zuflucht vor dem Alltag des Größenwahns, und fast wurde ihm der schweigsame Mann sympathisch. Henk Noorlander täuschte sich.
Anfangs verbreitete der Deutsche mit seiner lautlosen Anwesenheit eine Atmosphäre, in der die Raumtemperatur zu sinken schien. Aber eine gleichzeitig schützende und gefährliche Veranlagung sorgt dafür, dass sich die Menschen schnell an Situationen gewöhnen, die sie in einer ersten Konfrontation als bedrohlich empfanden. Wenn der Zustand einer Bedrohung durch unveränderte Wiederholungen zum Gemälde erstarrt, wird die Situation irgendwann zum Inventar der gewohnten Umgebung.
In der Wahrnehmung der Stammgäste wandelte sich von Breuer vom Gesandten eines verhassten Systems zu einem überflüssigen Einrichtungsgegenstand, dem man irgendwann keine Beachtung mehr schenkte. Aber auch Henk Noorlanders Gäste täuschten sich.
Dienstag, Oktober 10, 2006
Trialog
- Sprechen Sie.
- Worüber?
- Diese Unterhaltung war nicht meine Idee.
- Meine auch nicht.
- Aber wessen Idee soll es gewesen sein?
- Ich vermute, es war die Idee des Herrn hinter der Tastatur.
- Hinter welcher Tastatur?
- Die mit den Buchstaben und Zeichen. Sie werden doch wohl wissen, was eine Tastatur ist.
- Selbstverständlich weiß ich, was eine Tastatur ist, mein Herr. Aber ich kann keinen Herrn hinter einer Tastatur sehen.
- Natürlich können Sie ihn sehen, denn er existiert in Ihrer Phantasie.
- Wollen Sie damit sagen, dass es diesen Herrn nicht gibt?
- Doch, es gibt ihn. Aber nur, solange wir an ihn glauben.
- Was macht der Herr in unserer Phantasie?
- Er schreibt.
- Ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Und was schreibt er?
- Er schreibt über uns.
- Das heißt, er kennt uns?
- Erst seit Beginn dieser Unterhaltung. Aber mit jeder Äußerung lernt er uns besser kennen.
- Im Verlauf einer Unterhaltung lernt man sich automatisch besser kennen, das ist nichts besonderes. Aber er scheint uns zu belauschen, das gefällt mir nicht.
- Sagen Sie es ihm doch.
- Meinen Sie? Aber ich kenne ihn überhaupt nicht.
- Wie sollte er sonst erfahren, dass wir uns von ihm belästigt fühlen?
- Also gut. Hallo, Sie!
- ...
- Er antwortet nicht.
- Versuchen Sie es noch einmal, er wird bestimmt antworten.
- Hallo. Der Herr an der Tastatur, hören Sie mich?
- Ja, bitte?
- Ich empfinde Ihre Anwesenheit als ausgesprochen störend.
- Das weiß ich.
- Woher wollen Sie das wissen?
- Ich habe es soeben geschrieben.
- Wie können Sie darüber schreiben, bevor ich es gesagt habe?
- Ich habe es nicht bevor, sondern während Sie es gesagt haben, geschrieben.
- Protokollieren Sie etwa unsere persönliche Unterhaltung? Sind Sie Stenograph?
- Ich bin gleichzeitig Verursacher und Verfasser des Protokolls.
- Was wollen Sie damit sagen? Verursacher sind der Herr, mit dem ich mich soeben unterhalten habe, bevor ich Sie bemerkte, und ich.
- Sie täuschen sich, denn Sie existieren nur in meiner Phantasie.
- Das sagte der andere Herr auch. Aber über Sie.
- Wo ist ihr Gesprächspartner denn geblieben?
- Ich weiß es nicht. Bevor ich anfing, mich mit Ihnen zu unterhalten, war er noch hier.
- Und jetzt ist er weg.
- Merkwürdig.
- Nein. Er existierte nur, solange ich es wollte und ihm seine Beiträge zur Unterhaltung in den Mund legte.
- Soll das heißen, auch meine Äußerungen stammen aus Ihrem Protokoll und nicht umgekehrt.
- So ist es.
- Mein Herr, Sie scheinen verrückt zu sein.
- Sie wollen mir nicht glauben?
Escher erhob sich von seinem Stuhl und verschwand. Der schwarze Herr blieb stumm, bewegungslos und unvollkommen zurück, wie eine einzelne, in Blei gegossene Letter.
- Worüber?
- Diese Unterhaltung war nicht meine Idee.
- Meine auch nicht.
- Aber wessen Idee soll es gewesen sein?
- Ich vermute, es war die Idee des Herrn hinter der Tastatur.
- Hinter welcher Tastatur?
- Die mit den Buchstaben und Zeichen. Sie werden doch wohl wissen, was eine Tastatur ist.
- Selbstverständlich weiß ich, was eine Tastatur ist, mein Herr. Aber ich kann keinen Herrn hinter einer Tastatur sehen.
- Natürlich können Sie ihn sehen, denn er existiert in Ihrer Phantasie.
- Wollen Sie damit sagen, dass es diesen Herrn nicht gibt?
- Doch, es gibt ihn. Aber nur, solange wir an ihn glauben.
- Was macht der Herr in unserer Phantasie?
- Er schreibt.
- Ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Und was schreibt er?
- Er schreibt über uns.
- Das heißt, er kennt uns?
- Erst seit Beginn dieser Unterhaltung. Aber mit jeder Äußerung lernt er uns besser kennen.
- Im Verlauf einer Unterhaltung lernt man sich automatisch besser kennen, das ist nichts besonderes. Aber er scheint uns zu belauschen, das gefällt mir nicht.
- Sagen Sie es ihm doch.
- Meinen Sie? Aber ich kenne ihn überhaupt nicht.
- Wie sollte er sonst erfahren, dass wir uns von ihm belästigt fühlen?
- Also gut. Hallo, Sie!
- ...
- Er antwortet nicht.
- Versuchen Sie es noch einmal, er wird bestimmt antworten.
- Hallo. Der Herr an der Tastatur, hören Sie mich?
- Ja, bitte?
- Ich empfinde Ihre Anwesenheit als ausgesprochen störend.
- Das weiß ich.
- Woher wollen Sie das wissen?
- Ich habe es soeben geschrieben.
- Wie können Sie darüber schreiben, bevor ich es gesagt habe?
- Ich habe es nicht bevor, sondern während Sie es gesagt haben, geschrieben.
- Protokollieren Sie etwa unsere persönliche Unterhaltung? Sind Sie Stenograph?
- Ich bin gleichzeitig Verursacher und Verfasser des Protokolls.
- Was wollen Sie damit sagen? Verursacher sind der Herr, mit dem ich mich soeben unterhalten habe, bevor ich Sie bemerkte, und ich.
- Sie täuschen sich, denn Sie existieren nur in meiner Phantasie.
- Das sagte der andere Herr auch. Aber über Sie.
- Wo ist ihr Gesprächspartner denn geblieben?
- Ich weiß es nicht. Bevor ich anfing, mich mit Ihnen zu unterhalten, war er noch hier.
- Und jetzt ist er weg.
- Merkwürdig.
- Nein. Er existierte nur, solange ich es wollte und ihm seine Beiträge zur Unterhaltung in den Mund legte.
- Soll das heißen, auch meine Äußerungen stammen aus Ihrem Protokoll und nicht umgekehrt.
- So ist es.
- Mein Herr, Sie scheinen verrückt zu sein.
- Sie wollen mir nicht glauben?
Escher erhob sich von seinem Stuhl und verschwand. Der schwarze Herr blieb stumm, bewegungslos und unvollkommen zurück, wie eine einzelne, in Blei gegossene Letter.
Labels: Escher
Montag, Oktober 09, 2006
Voodoo Display #4

Laut Auskünften meines Schusters trägt der Elvisimitator den Namen Rudi und war einst Briefträger im Bezirk Berger Straße.
Labels: Voodoo displays
Sonntag, Oktober 08, 2006
Das Unglück im Glück der Adrenalina Pura
Sie war mit ihrem Leben zufrieden. Nachdem Nico aus dem Alptraum ihrer Ehe verschwunden war, kam sie mit den drei Kindern besser über die Runden. In den unberechenbaren Gezeiten seiner Sucht kannte er irgendwann nur noch die Rücksicht auf das Raubtier in ihm, das nach Fütterungen schrie und damit drohte, ihn aufzufressen, wenn seine ständig wachsenden Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Die Probleme waren mit jedem neuen Versuch einer Lösung größer geworden. Später erzählte man, dass Nico sich in einem anderen Stadtteil einer bewaffneten Quadrilha, den Manos do Inferno, angeschlossen habe und angeblich für Drogen tötete.
Adriana, die wegen ihrer gutmütigen Art, sich zu bewegen und zu sprechen, unter dem ironischen Spitznamen Adrenalina über die Grenzen der Nachbarschaft bekannt war, wurde mit Nicos Weggang auch vom Pech verlassen. Sie fand eine bessere Arbeit im Haushalt eines europäischen Diplomaten, und obwohl sie jeden Tag lange Busfahrten in Kauf nehmen musste, um von ihrer Favela in den anderen Teil der Stadt zu kommen, hatte sie das Gefühl, dass ihr Weg aufwärts führte.
Mitten in die Zufriedenheit platzten zwei Herren, die graue Anzüge und elegante Schuhe trugen. Mit ernsten Gesichtern sahen sich die Männer im einzigen Zimmer des schlichten Hauses um, wo der kleine Luíz auf dem Lehmboden spielte. Dann teilten sie Adrenalina eine Nachricht mit, die auf einer verschwindend geringen, mathematischen Wahrscheinlichkeit beruhte.
- Senhora Pura, ihre Losnummer wurde gezogen.
Adrenalina liebte es, beim Jogo do bicho um kleine Einsätze zu spielen. Manchmal kreuzte sie das richtige Tiersymbol an und gewann ein paar Reais. Außerdem kaufte sie regelmäßig ein Los für die staatliche Lotterie. Aber beim Spiel um das große Geld zählte nur die Illusion, um die man sein Leben bereicherte, und nicht die tatsächliche Chance auf unvorstellbare Gewinne. Adrenalina erschrak, als einer der grauen Männer die Summe nannte.
Kaum waren die Boten des Glücks verschwunden, standen die Medien vor der Tür. Und noch bevor der erste Artikel in der Zeitung über Adrenalinas Glück erschien, tauchte Nico aus dem Schatten der Manos do Inferno auf. Er machte Ansprüche geltend, und Adrenalina gab ihm Geld. Aber er empfand Adrenalinas Reichtum als Demütigung. Eines Nachts erschlug er sie mit einem Ziegelstein. Jeder wusste, wer der Täter war. Jeder drehte den Kopf zur Seite, wenn Nico vorbeiging. Jeder wollte überleben.
Da er Adrenalinas Ehemann und damit ihr nächster Angehöriger war, erbte er das gesamte Vermögen. Noch bevor seine Kinder im Heim landeten und Nico verschwinden konnte, fand man ihn mit einem Kopfschuss auf der Müllkippe. Nach seinem Tod betrachteten sich die Manos do Inferno als nächste Angehörige, und das Geld kehrte wieder in den üblichen Kreislauf zurück.
(Diese Geschichte ist vollständig erfunden. In der Realität würde so etwas aufgrund der verschwindend geringen, mathematischen Wahrscheinlichkeit vermutlich nie passieren.)
Adriana, die wegen ihrer gutmütigen Art, sich zu bewegen und zu sprechen, unter dem ironischen Spitznamen Adrenalina über die Grenzen der Nachbarschaft bekannt war, wurde mit Nicos Weggang auch vom Pech verlassen. Sie fand eine bessere Arbeit im Haushalt eines europäischen Diplomaten, und obwohl sie jeden Tag lange Busfahrten in Kauf nehmen musste, um von ihrer Favela in den anderen Teil der Stadt zu kommen, hatte sie das Gefühl, dass ihr Weg aufwärts führte.
Mitten in die Zufriedenheit platzten zwei Herren, die graue Anzüge und elegante Schuhe trugen. Mit ernsten Gesichtern sahen sich die Männer im einzigen Zimmer des schlichten Hauses um, wo der kleine Luíz auf dem Lehmboden spielte. Dann teilten sie Adrenalina eine Nachricht mit, die auf einer verschwindend geringen, mathematischen Wahrscheinlichkeit beruhte.
- Senhora Pura, ihre Losnummer wurde gezogen.
Adrenalina liebte es, beim Jogo do bicho um kleine Einsätze zu spielen. Manchmal kreuzte sie das richtige Tiersymbol an und gewann ein paar Reais. Außerdem kaufte sie regelmäßig ein Los für die staatliche Lotterie. Aber beim Spiel um das große Geld zählte nur die Illusion, um die man sein Leben bereicherte, und nicht die tatsächliche Chance auf unvorstellbare Gewinne. Adrenalina erschrak, als einer der grauen Männer die Summe nannte.
Kaum waren die Boten des Glücks verschwunden, standen die Medien vor der Tür. Und noch bevor der erste Artikel in der Zeitung über Adrenalinas Glück erschien, tauchte Nico aus dem Schatten der Manos do Inferno auf. Er machte Ansprüche geltend, und Adrenalina gab ihm Geld. Aber er empfand Adrenalinas Reichtum als Demütigung. Eines Nachts erschlug er sie mit einem Ziegelstein. Jeder wusste, wer der Täter war. Jeder drehte den Kopf zur Seite, wenn Nico vorbeiging. Jeder wollte überleben.
Da er Adrenalinas Ehemann und damit ihr nächster Angehöriger war, erbte er das gesamte Vermögen. Noch bevor seine Kinder im Heim landeten und Nico verschwinden konnte, fand man ihn mit einem Kopfschuss auf der Müllkippe. Nach seinem Tod betrachteten sich die Manos do Inferno als nächste Angehörige, und das Geld kehrte wieder in den üblichen Kreislauf zurück.
(Diese Geschichte ist vollständig erfunden. In der Realität würde so etwas aufgrund der verschwindend geringen, mathematischen Wahrscheinlichkeit vermutlich nie passieren.)
Samstag, Oktober 07, 2006
Lotto ist Opium für das Volk
Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Auffassungen von Glück gehört nicht zu meinen zentralen Interessen. Aber die identische Motivation sämtlicher Lottospieler ist ein bemerkenswertes Phänomen, denn an das Verteilen der Kreuze auf dem Lottoschein sind immer dieselben Hoffnungen geknüpft. Alle Spieler wollen mit einem vergleichbar geringen Einsatz, und vor allem ohne Arbeitsaufwand, ein maximales Ergebnis erzielen. Die zufällige Erreichung dieses Ziels wird mit dem Glücksbegriff und der Vorstellung von einer sich erfüllenden Freiheit verbunden.
Die Logik der Vernunft spielt nachweisbar keine Rolle, denn trotz der geringen mathematischen Wahrscheinlichkeit gibt es bei den Ziehungen der Lottozahlen immer wieder Spieler, die sich für die zutreffende Zahlenkombination entschieden haben, als sie ihre Kreuze verteilten.
Der Wunsch nach materieller Unabhängigkeit ist nicht verwerflich. Aber umfangreicher Besitz kann die Erwartung von Freiheit nicht erfüllen, denn es kommt nicht darauf an, was man besitzt, sondern wie man mit seinem Besitz umgeht. Mit wachsendem Besitz wächst auch die Verantwortung, und viele Gewinner hoher Lotteriesummen sind mit ihrem plötzlichen Reichtum überfordert. Scheinbare Befriedigung durch unlimitierten Konsum stößt schnell an Sättigungsgrenzen. Auch ohne finanziellen Reichtum ist es schon schwer genug, das Dasein mit Sinn zu füllen, und vermutlich wechselt in einem vergoldeten Käfig die ständig lauernde Eintönigkeit des Alltags nur ihre Maske.
Ich habe noch nie Lotto gespielt. Meine Befürchtung, den Jackpot zu knacken und anschließend in einer finanziellen Amnesie alle guten Vorsätze zu vergessen, wäre zu groß. Lieber investiere ich in ein Dauerlos für das Spiel um den geistigen Reichtum. In der städtischen Bibliothek. Dort ist die mathematische Wahrscheinlichkeit des Gewinns höher, und gelegentlich knackt man sogar den Jackpot.
Die Logik der Vernunft spielt nachweisbar keine Rolle, denn trotz der geringen mathematischen Wahrscheinlichkeit gibt es bei den Ziehungen der Lottozahlen immer wieder Spieler, die sich für die zutreffende Zahlenkombination entschieden haben, als sie ihre Kreuze verteilten.
Der Wunsch nach materieller Unabhängigkeit ist nicht verwerflich. Aber umfangreicher Besitz kann die Erwartung von Freiheit nicht erfüllen, denn es kommt nicht darauf an, was man besitzt, sondern wie man mit seinem Besitz umgeht. Mit wachsendem Besitz wächst auch die Verantwortung, und viele Gewinner hoher Lotteriesummen sind mit ihrem plötzlichen Reichtum überfordert. Scheinbare Befriedigung durch unlimitierten Konsum stößt schnell an Sättigungsgrenzen. Auch ohne finanziellen Reichtum ist es schon schwer genug, das Dasein mit Sinn zu füllen, und vermutlich wechselt in einem vergoldeten Käfig die ständig lauernde Eintönigkeit des Alltags nur ihre Maske.
Ich habe noch nie Lotto gespielt. Meine Befürchtung, den Jackpot zu knacken und anschließend in einer finanziellen Amnesie alle guten Vorsätze zu vergessen, wäre zu groß. Lieber investiere ich in ein Dauerlos für das Spiel um den geistigen Reichtum. In der städtischen Bibliothek. Dort ist die mathematische Wahrscheinlichkeit des Gewinns höher, und gelegentlich knackt man sogar den Jackpot.
Freitag, Oktober 06, 2006
Arambol
Die Römerin war an jeder sichtbaren Körperstelle tätowiert. Alle Bilder auf ihrer Haut waren in einem sehr einfachen Stil gestochen und zeigten die Umrisse von Tieren. Schafe, Hunde, Schweine, Katzen, Ziegen, Hühner. Jede Tätowierung sollte eines der Tiere darstellen, die in ihrem Haus gelebt hatten. Immer, wenn ein Tier gestorben war, hatte sie ihren blinden Mann gebeten, es zur Erinnerung mit schwarzer Tinte unter ihre Haut zu stechen. Der Blinde hatte eine Gabe, das Wesen der Formen zu erkennen und auf verschiedene Weisen darzustellen.
Dann starb der Blinde. Unerwartet, ein Tumor hatte sein Hirn zerfressen. In ihrer Trauer trennte sich die Römerin von den verbliebenen Tieren und verkaufte das Haus. Ich lernte sie im Bus zwischen Bombay und Panaji kennen. Während der Fahrt injizierte sie sich eine Dosis Insulin in die Haut über ihrem Bauch. In meinem Bedürfnis nach Diskretion hatte ich den Kopf zur Seite gedreht, aber sie missverstand die höflich gemeinte Geste. Mit einem aggressiven Ton in der Stimme erklärte sie, dass es sich nicht um Drogen handelte, sondern um ein notwendiges Medikament, das sie aufgrund ihrer Diabetes spritzen musste. Ich antwortete, wenn es außer Insulin einen Stoff gäbe, den man sich in die Bauchfalte spritzt, würde ich ihn mit Sicherheit kennen. Die Römerin lachte, und die raue Stimme klang noch vulgärer, als wenn sie mit ihrem rollenden Akzent englische Sätze formulierte, die zu einem großen Teil aus Flüchen bestanden.
Sie sprach davon, dass sie mit der Reise nach Indien eine Suche nach ihrem innersten Ich angetreten hatte und ein neues Leben finden wollte. Zu jener Zeit wusste ich bereits, dass man sich in Indien leicht verlieren, aber niemals finden konnte. Mir waren zu viele begegnet, die den letzten Rest ihrer Identität im Land der bunten Götter verloren hatten. Sie verweigerten sich der Erkenntnis, dass sich unter dem Schleier der Exotik nichts anderes verbarg, als hinter dem Nebel des Alltags.
Wir begegneten uns wieder in Arambol. Die Römerin teilte sich eine Hütte mit anderen Italienern, die sich gegen jede Form der Realität entschieden hatten. Auf den ersten Blick konnte man erkennen, dass ihr das Insulin zur Erhaltung der Illusion von einem schwerelosen Leben nicht mehr genügte.
Nach einer dreitägigen Party entdeckte man den toten Körper der Römerin am Strand von Anjuna. Ich hoffe, dass sie ihr neues Leben gefunden hat. Obwohl ich nicht daran glaube.
Dann starb der Blinde. Unerwartet, ein Tumor hatte sein Hirn zerfressen. In ihrer Trauer trennte sich die Römerin von den verbliebenen Tieren und verkaufte das Haus. Ich lernte sie im Bus zwischen Bombay und Panaji kennen. Während der Fahrt injizierte sie sich eine Dosis Insulin in die Haut über ihrem Bauch. In meinem Bedürfnis nach Diskretion hatte ich den Kopf zur Seite gedreht, aber sie missverstand die höflich gemeinte Geste. Mit einem aggressiven Ton in der Stimme erklärte sie, dass es sich nicht um Drogen handelte, sondern um ein notwendiges Medikament, das sie aufgrund ihrer Diabetes spritzen musste. Ich antwortete, wenn es außer Insulin einen Stoff gäbe, den man sich in die Bauchfalte spritzt, würde ich ihn mit Sicherheit kennen. Die Römerin lachte, und die raue Stimme klang noch vulgärer, als wenn sie mit ihrem rollenden Akzent englische Sätze formulierte, die zu einem großen Teil aus Flüchen bestanden.
Sie sprach davon, dass sie mit der Reise nach Indien eine Suche nach ihrem innersten Ich angetreten hatte und ein neues Leben finden wollte. Zu jener Zeit wusste ich bereits, dass man sich in Indien leicht verlieren, aber niemals finden konnte. Mir waren zu viele begegnet, die den letzten Rest ihrer Identität im Land der bunten Götter verloren hatten. Sie verweigerten sich der Erkenntnis, dass sich unter dem Schleier der Exotik nichts anderes verbarg, als hinter dem Nebel des Alltags.
Wir begegneten uns wieder in Arambol. Die Römerin teilte sich eine Hütte mit anderen Italienern, die sich gegen jede Form der Realität entschieden hatten. Auf den ersten Blick konnte man erkennen, dass ihr das Insulin zur Erhaltung der Illusion von einem schwerelosen Leben nicht mehr genügte.
Nach einer dreitägigen Party entdeckte man den toten Körper der Römerin am Strand von Anjuna. Ich hoffe, dass sie ihr neues Leben gefunden hat. Obwohl ich nicht daran glaube.
Dienstag, Oktober 03, 2006
Drachenkot
Er hatte sie während seiner letzten Geschäftsreise auf dem Nachtmarkt für Delikatessen und Potenzmittel in Hongkong gekauft. Eine fahle Zwergin, die über einen einzigen Zahn in ihrer Mundhöhle und ein vernarbtes Loch an der Stelle ihres rechten Auges verfügte, drehte Georg Santorius die beiden Eier unter dem Hinweis an, dass er sie zwar möglichst schnell zubereiten, aber auf eine Dosierung nach Vorschrift achten solle. Die Alte behauptete, es handele sich um Dracheneier, die aus einer unzugänglichen Gegend in Kamtschatka stammten und wollte ihm zusätzlich eine kantonesische Dosierungsanleitung verkaufen. Aber Georg Santorius hatte nicht vor, das angebliche Drachengelege zwecks Doping seiner Manneskraft zu verspeisen. Die karmesinroten Eier waren als Geschenk für seine Frau Emily gedacht, die Eier aus aller Welt sammelte und präparierte.
Als Georg nach seiner Rückkehr den Koffer öffnete, fauchten ihn zwei drollige Drachenbabies zwischen der gebrauchten Wäsche an, worin er die Eier eingewickelt hatte. Emily war begeistert.
Aber nach einigen Wochen gerieten die Drachen zunehmend außer Kontrolle, denn sie ließen sich nicht erziehen. Als Haustiere waren die beiden ungeeignet, und Emilys anfängliche Muttergefühle wichen ihrem Hausfraueninstinkt.
- Wir sind doch keine Drachenaufzuchtstation,
beschwerte sich Emily, die aufgrund ihrer nordirischen Herkunft nicht leicht aus der Fassung zu bringen war, was die Existenz von Fabelwesen betraf. Aber der Kot, den die kleinen Drachen überall in der Wohnung hinterließen, stank höllisch und ließ sich nicht ohne Rückstände von den Perserteppichen entfernen. Die beiden ignorierten das eigens angeschaffte Katzenklo beharrlich. Irgendwann verlor Emily die Geduld.
- Die Drachen müssen weg!
Weil es sich bei den stinkenden Wesen um Illegale handelte, die er im Entwicklungsstadium über die Grenze am Frankfurter Flughafen geschmuggelt hatte, sah Georg keine andere Möglichkeit, als die beiden in eine abgenutzte Reisetasche zu stecken und während einer Neumondnacht den Kanaldeckel am Ende einer unbeleuchteten Sackgasse anzuheben, um die Drachen zu entsorgen.
Seither lebten in der Kanalisation unter dem Frankfurter Westend zwei Drachen aus Kamtschatka. Ein städtischer Mitarbeiter, der von absonderlichen Beobachtungen während seiner Tätigkeiten im Tunnelsystem unter der Stadt berichtete, wurde wegen wiederholtem Alkoholkonsum während der Dienstzeiten abgemahnt.
Aus dem Kot im Perserteppich entwickelten sich auf unerklärliche Weise sieben karmesinrote Eier.
Georg konnte der Versuchung nicht widerstehen und bereitete sich aus den sieben Dracheneiern ein Omelett. Es schmeckte köstlich, führte allerdings dazu, dass die Ehe von Georg und Emily Santorius in die Brüche ging. Um seinem Trieb Herr zu werden, suchte sich Georg eine neue Herausforderung in der Pornoindustrie. Sein Leben wäre anders verlaufen, wenn er ein paar Hong Kong Dollar in die Dosierungsanleitung von Drachenomelett und eine Übersetzung des Beipackzettels aus dem Kantonesischen investiert hätte.
--
>> Ein anderer Drachentöter
>> Noch ein anderer Georg
Als Georg nach seiner Rückkehr den Koffer öffnete, fauchten ihn zwei drollige Drachenbabies zwischen der gebrauchten Wäsche an, worin er die Eier eingewickelt hatte. Emily war begeistert.
Aber nach einigen Wochen gerieten die Drachen zunehmend außer Kontrolle, denn sie ließen sich nicht erziehen. Als Haustiere waren die beiden ungeeignet, und Emilys anfängliche Muttergefühle wichen ihrem Hausfraueninstinkt.
- Wir sind doch keine Drachenaufzuchtstation,
beschwerte sich Emily, die aufgrund ihrer nordirischen Herkunft nicht leicht aus der Fassung zu bringen war, was die Existenz von Fabelwesen betraf. Aber der Kot, den die kleinen Drachen überall in der Wohnung hinterließen, stank höllisch und ließ sich nicht ohne Rückstände von den Perserteppichen entfernen. Die beiden ignorierten das eigens angeschaffte Katzenklo beharrlich. Irgendwann verlor Emily die Geduld.
- Die Drachen müssen weg!
Weil es sich bei den stinkenden Wesen um Illegale handelte, die er im Entwicklungsstadium über die Grenze am Frankfurter Flughafen geschmuggelt hatte, sah Georg keine andere Möglichkeit, als die beiden in eine abgenutzte Reisetasche zu stecken und während einer Neumondnacht den Kanaldeckel am Ende einer unbeleuchteten Sackgasse anzuheben, um die Drachen zu entsorgen.
Seither lebten in der Kanalisation unter dem Frankfurter Westend zwei Drachen aus Kamtschatka. Ein städtischer Mitarbeiter, der von absonderlichen Beobachtungen während seiner Tätigkeiten im Tunnelsystem unter der Stadt berichtete, wurde wegen wiederholtem Alkoholkonsum während der Dienstzeiten abgemahnt.
Aus dem Kot im Perserteppich entwickelten sich auf unerklärliche Weise sieben karmesinrote Eier.
Georg konnte der Versuchung nicht widerstehen und bereitete sich aus den sieben Dracheneiern ein Omelett. Es schmeckte köstlich, führte allerdings dazu, dass die Ehe von Georg und Emily Santorius in die Brüche ging. Um seinem Trieb Herr zu werden, suchte sich Georg eine neue Herausforderung in der Pornoindustrie. Sein Leben wäre anders verlaufen, wenn er ein paar Hong Kong Dollar in die Dosierungsanleitung von Drachenomelett und eine Übersetzung des Beipackzettels aus dem Kantonesischen investiert hätte.
--
>> Ein anderer Drachentöter
>> Noch ein anderer Georg
Montag, Oktober 02, 2006
Bound for the sea of live and Tod
Romanen gebe ich eine Chance von maximal fünf Seiten, um mich in die Handlung zu ziehen. Wenn es dem Autor in dieser Zeitspanne nicht gelingt, lese ich noch einige Abschnitte quer und lege das Buch dann meistens zur Seite. Die Lebenszeit ist sowieso zu limitiert, um sie mit der Lektüre von mittelmäßigen, epischen Texten zu verplempern. Daher lese ich auch meinen eigenen Kram kein weiteres Mal, nachdem ich einen Schlussstrich unter einen Text gezogen habe. Ich lese lieber die Tageszeitungen. Oder philosophische Texte. Oder im Großen Brehm. Oder Fachliteratur über Musik, Astronomie, Linguistik. Oder Wikipedia.
Es passiert sehr selten, dass ich einen gedruckten Text der epischen Gattung mehrfach lese. Noch seltener im Internet. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Dieser Text einschließlich der dazu gehörenden Bilder und abschließenden Kommentare berührt mich sehr tief und stellt für mich eine existenzielle Metapher dar.
Der Text wurde von einem weit gereisten Seemann aus dem Allgäu verfasst. Ich habe ein Bookmark auf die Geschichte gesetzt und lese sie immer wieder, vor allem an Tagen wie heute, an denen mir der Regen die Seele durch den Gulli ins Schwarze Meer schwemmt.
Bound for Veracruz (1) zeigt auf eine nicht zu übertreffende, authentische Weise die Bandbreite des Lebens von Fröhlichkeit bis Trauer. Wer mehr über den Autor erfahren möchte, sollte das kürzlich in der taz erschienenes Feature Der Seeblogger lesen. Oder einfach alle anderen Texte in seinem Weblog Club der halbtoten Dichter. Es rentiert sich.
Es passiert sehr selten, dass ich einen gedruckten Text der epischen Gattung mehrfach lese. Noch seltener im Internet. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Dieser Text einschließlich der dazu gehörenden Bilder und abschließenden Kommentare berührt mich sehr tief und stellt für mich eine existenzielle Metapher dar.
Der Text wurde von einem weit gereisten Seemann aus dem Allgäu verfasst. Ich habe ein Bookmark auf die Geschichte gesetzt und lese sie immer wieder, vor allem an Tagen wie heute, an denen mir der Regen die Seele durch den Gulli ins Schwarze Meer schwemmt.
Bound for Veracruz (1) zeigt auf eine nicht zu übertreffende, authentische Weise die Bandbreite des Lebens von Fröhlichkeit bis Trauer. Wer mehr über den Autor erfahren möchte, sollte das kürzlich in der taz erschienenes Feature Der Seeblogger lesen. Oder einfach alle anderen Texte in seinem Weblog Club der halbtoten Dichter. Es rentiert sich.
Sie war ein Modell, und sie sah nur gut aus
Ihre grazilen Bewegungen waren von einer unerreichten Anmut. Wenn Li Chong über den Laufsteg ging, bildete ihr Körper eine Symbiose mit den Textilien, der Musik und dem eleganten Licht der Scheinwerfer. Sie verstand es, mit ihren Auftritten eine ideale Atmosphäre im Sinn der Modeschöpfer zu gestalten. Ihre Gagen waren astronomisch, aber aufgrund des Bestellvolumens nach jeder Schau angemessen. Li Chong hatte eine hypnotisierende Wirkung auf die Einkäufer der großen Ladenketten. Ihr großer, und dabei hauchzarter Körper schien auf ein schwebendes Nichts reduziert, so dass allein die Kleider zur Geltung kamen. Kein anderes Mädchen war von einer schmaleren Gestalt, und man fragte sich, ob Li Chong jemals Kalorien zu sich nahm.
Für die Medien war das blasse Mädchen aus dem fernen Osten unerreichbar. Nach jedem Auftritt schien sie sich in Luft aufzulösen, und es rankten sich Mythen um die Persönlichkeit des Supermodells. Im Gegensatz zu Li Chong lösten sich dann jedoch die Mythen in Luft auf.
Dem investigativen Reporter eines Boulevard-Magazins gelang es, nach einer Modenschau in Li Chongs Garderobe vorzudringen. Was er dort sah, ließ ihn im ersten Moment mit seinem Geisteszustand hadern. Der blasse Rumpf des Modells saß auf einem Frisierstuhl, während der Kopf auf einem Metallkoffer lag. Die Augen starrten ihn ausdruckslos an. Nachdem er sich von dem plötzlichen Schock erholt hatte, registrierte er die Kabel. Der Journalist begann sofort, zu fotografieren.
Nachdem sich die erste Aufregung in den Medien gelegt hatte, wurde das Phänomen der künstlichen Modells gesellschaftlich akzeptiert. Eine aufkommende Technikbegeisterung in der Branche brachte es mit sich, dass bald nur noch Androiden auf den Laufstegen zu sehen waren. Wenn es darum ging, die Kollektionen der Designer als wandelnde Kleiderständer auf den Laufstegen der Modemetropolen zu präsentieren, waren die Modelle aus der Fabrikation des chinesischen Elektronikriesen Cybotao an Perfektion nicht zu übertreffen.
Irgendwann erinnerten sich die Medien an die Models aus Fleisch und Blut, und an die Skandale aus dem Privatleben der Mädchen. Die Androiden hatten kein Privatleben und keine Biografie. Es entstand ein Bedarf an menschlichen Kleiderpuppen, hinter denen sich ein Charakter verbarg. Modell wurde wieder zum Traumberuf von Heerscharen magersüchtiger Kinder.
In den Labors von Cybotao löste man auch dieses Problem. Die nächste Generation war mit perfekt skandalösen Persönlichkeiten ausgestattet.
Für die Medien war das blasse Mädchen aus dem fernen Osten unerreichbar. Nach jedem Auftritt schien sie sich in Luft aufzulösen, und es rankten sich Mythen um die Persönlichkeit des Supermodells. Im Gegensatz zu Li Chong lösten sich dann jedoch die Mythen in Luft auf.
Dem investigativen Reporter eines Boulevard-Magazins gelang es, nach einer Modenschau in Li Chongs Garderobe vorzudringen. Was er dort sah, ließ ihn im ersten Moment mit seinem Geisteszustand hadern. Der blasse Rumpf des Modells saß auf einem Frisierstuhl, während der Kopf auf einem Metallkoffer lag. Die Augen starrten ihn ausdruckslos an. Nachdem er sich von dem plötzlichen Schock erholt hatte, registrierte er die Kabel. Der Journalist begann sofort, zu fotografieren.
Nachdem sich die erste Aufregung in den Medien gelegt hatte, wurde das Phänomen der künstlichen Modells gesellschaftlich akzeptiert. Eine aufkommende Technikbegeisterung in der Branche brachte es mit sich, dass bald nur noch Androiden auf den Laufstegen zu sehen waren. Wenn es darum ging, die Kollektionen der Designer als wandelnde Kleiderständer auf den Laufstegen der Modemetropolen zu präsentieren, waren die Modelle aus der Fabrikation des chinesischen Elektronikriesen Cybotao an Perfektion nicht zu übertreffen.
Irgendwann erinnerten sich die Medien an die Models aus Fleisch und Blut, und an die Skandale aus dem Privatleben der Mädchen. Die Androiden hatten kein Privatleben und keine Biografie. Es entstand ein Bedarf an menschlichen Kleiderpuppen, hinter denen sich ein Charakter verbarg. Modell wurde wieder zum Traumberuf von Heerscharen magersüchtiger Kinder.
In den Labors von Cybotao löste man auch dieses Problem. Die nächste Generation war mit perfekt skandalösen Persönlichkeiten ausgestattet.
Sonntag, Oktober 01, 2006
Das Lebenswerk des Varios Entonzes
Er hatte sein gesamtes Leben damit verbracht, das Bild zu malen. Bereits während seiner Kindheit entwickelte Varios Entonzes eine genaue Vorstellung davon, was auf dem Bild zu sehen sein sollte. Die Bewegungen des Jungen waren zu ungelenk, um seine Vorstellung mit Hilfe der Buntstifte auf das Papier zu übertragen. Daher befasste er sich bald mit dem Handwerk und den Techniken der bildenden Künste. An seinem zehnten Geburtstag bekam Varios eine Leinwand geschenkt, vor der er die meiste Zeit seines restlichen Lebens verbringen würde. Er studierte das Zeichnen und die Malerei, um seine erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Erschaffung des einen Bildes zu verwenden. Das Ergebnis sollte eine Abbildung von allem und eine Erklärung für alles sein. Das Bild sollte das Wesentliche der Welt darstellen.
Varios wusste, dass er für sein Vorhaben keine großen Flächen benötigte. Alles würde auf die kleine Leinwand passen, denn sogar in seinem Kopf fand es Platz. So malte er ohne Unterlass an dem Bild. Er ließ sich einen Pinsel fertigen, der aus einem einzigen Haar bestand. Das Haar war dünn wie eine Spinnwebe, und für jeden der Millionen Pinselstriche ließ sich Varios Entonzes viel Zeit. Sämtliche Stellen der Leinwand übermalte er immer wieder, bis er an seinem achtundachtzigsten Geburtstag mit dem Ergebnis zufrieden war. Endlich. Varios legte den Pinsel aus der Hand, verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete sein Lebenswerk aus einer angemessenen Distanz. Alles war perfekt.
Aber bald, nachdem er das Werk vollendet hatte, entwand sich ihm der Sinn seines Daseins. Eine grenzenlose Leere machte sich in seinem verbrauchten Leben breit. Hinzu kamen Zweifel, die mit jedem Mal wuchsen und unerbittlicher wurden, wenn er das Bild betrachtete. Er entdeckte kleine Fehler. Es wurden immer mehr Fehler, und die Fehler addierten sich zu einem einzigen großen Fehler. Sein Lebenswerk war am Ende nur ein Entwurf.
Nachdem Varios die Terpentinreste aus den alten Blechdosen im Zimmer verteilt hatte, warf er einen letzten, traurigen Blick auf das Bild. Dann entzündete er ein Streichholz und ließ es, nicht ohne dramatische Geste, fallen.
Das Feuer wollte jedoch auf dem dicken Wollteppich nicht anständig lodern, und der Schwelbrand konnte schnell gelöscht werden, nachdem aufmerksame Passanten die Feuerwehr verständigt hatten. Der Kunstmaler Varios Entonzes starb an einer Rauchvergiftung. Er hinterließ keine Angehörigen, daher beauftragte der Eigentümer der kleinen Dachwohnung eine Entrümpelungsfirma. Einem Mitarbeiter der Firma gefiel das Bild des Varios Entonzes. Der Rahmen war zwar ein einer Ecke leicht verkohlt, aber er nahm das Bild mit nach Hause und hängte es über das Sofa im Wohnzimmer.
Das Lebenswerk des Varios Entonzes zeigte einen röhrenden Hirsch.
Kurze Zeit, nachdem er das Bild aufgehängt hatte, begann der kleine Sohn des Möbelpackers, sich auffällig häufig mit seinen Buntstiften zu beschäftigen.
Varios wusste, dass er für sein Vorhaben keine großen Flächen benötigte. Alles würde auf die kleine Leinwand passen, denn sogar in seinem Kopf fand es Platz. So malte er ohne Unterlass an dem Bild. Er ließ sich einen Pinsel fertigen, der aus einem einzigen Haar bestand. Das Haar war dünn wie eine Spinnwebe, und für jeden der Millionen Pinselstriche ließ sich Varios Entonzes viel Zeit. Sämtliche Stellen der Leinwand übermalte er immer wieder, bis er an seinem achtundachtzigsten Geburtstag mit dem Ergebnis zufrieden war. Endlich. Varios legte den Pinsel aus der Hand, verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete sein Lebenswerk aus einer angemessenen Distanz. Alles war perfekt.
Aber bald, nachdem er das Werk vollendet hatte, entwand sich ihm der Sinn seines Daseins. Eine grenzenlose Leere machte sich in seinem verbrauchten Leben breit. Hinzu kamen Zweifel, die mit jedem Mal wuchsen und unerbittlicher wurden, wenn er das Bild betrachtete. Er entdeckte kleine Fehler. Es wurden immer mehr Fehler, und die Fehler addierten sich zu einem einzigen großen Fehler. Sein Lebenswerk war am Ende nur ein Entwurf.
Nachdem Varios die Terpentinreste aus den alten Blechdosen im Zimmer verteilt hatte, warf er einen letzten, traurigen Blick auf das Bild. Dann entzündete er ein Streichholz und ließ es, nicht ohne dramatische Geste, fallen.
Das Feuer wollte jedoch auf dem dicken Wollteppich nicht anständig lodern, und der Schwelbrand konnte schnell gelöscht werden, nachdem aufmerksame Passanten die Feuerwehr verständigt hatten. Der Kunstmaler Varios Entonzes starb an einer Rauchvergiftung. Er hinterließ keine Angehörigen, daher beauftragte der Eigentümer der kleinen Dachwohnung eine Entrümpelungsfirma. Einem Mitarbeiter der Firma gefiel das Bild des Varios Entonzes. Der Rahmen war zwar ein einer Ecke leicht verkohlt, aber er nahm das Bild mit nach Hause und hängte es über das Sofa im Wohnzimmer.
Das Lebenswerk des Varios Entonzes zeigte einen röhrenden Hirsch.
Kurze Zeit, nachdem er das Bild aufgehängt hatte, begann der kleine Sohn des Möbelpackers, sich auffällig häufig mit seinen Buntstiften zu beschäftigen.






